
HOME | | | Sitemap
von
klausjans.de | | |
Ein
Lied-Libretto-Text von Wolfgang
Müller von
Königswinter für die Ouvertüre von Robert Schumann, 1853
uraufgeführt,
für das 31. Niederrheinische Musikfest Düsseldorf. (Der Urtext von M.
Claudius wurde von W. M. v. K. wohl auch aus einem besonderen Grund
stark verändert ... für die
Absicht der Schumann-Komposition.) Der 17.5.1853 war bereits ein
Dienstag. Der
16.5.1853 war der Pfingstmontag.
Wolfgang Müller und Robert Schumann kannten sich. Müller war in deren
Düsseldorfer Zeit zudem Arzt für Clara und Robert Schumann, namentlich
(so er als Arzt) Peter Wilhelm
Carl Müller, auch laut Adressbuch. Sein Künstlername aber war schon
lange parallel dazu "Wolfgang Müller", später dann auch mit dem festen
Namens-Zusatz "von
Königswinter".
Schumann durchlitt in Düsseldorf etliche Krisen, war
beim Orchester sehr unbeliebt; Schumann gab dann sogar die
Leitungstätigkeit als
Musikdirektor auf. Am 27. Februar 1854 stieg er am Rhein
(Höhe Oberkassel) über das Geländer einer Ponton-Brücke und stürzte
sich in
den Fluss, wurde aber gerettet. Schumann würde sehr bald danach
Düsseldorf verlassen, denn er kam am 4.3.1854 nach Endenich (damals
noch bei Bonn) ins
Sanatorium "Anstalt für Behandlung und Pflege von
Gemütskranken und Irren" wegen seines
immer wirrer werdenden Zustandes. (Wolfgang
Müller von Königswinter zog seinerseits bereits mit seiner Familie
offiziell am
16.7.1853 als Arzt und
Schriftsteller fest nach Köln.)
Auf dieser Web-Seite geht es um a) W. Müllers Text-Version zum
Rheinweinlied b) das 4-tägige Gesangfest/Gesangsfest von August 1852 in
Düsseldorf c) das
31. Niederrheinische Musikfest (diesmal in Düsseldorf als
"Austragungsort") von Pfingsten
1853 ... und um die Geislersche Halle bzw. Tonhalle im Geislerschen
Garten in Düsseldorf. (= Alte Halle und Neue Halle im Geislerschen
Garten: ACHTUNG!
Es gab zwei!)

Siehe
auch Tabellarische
Zeitleisten-Biografie zu Wolfgang
Müller von
Königswinter.

Siehe aber auch noch
Liste
Bücher Publikationen Veröffentlichungen
zu Wolfgang Müller von Königswinter.
Alpabetische
Titelliste der Gedichte Texte Buchtitel
et al. Wolfgang
Müller von Königswinter
Einige Personen
zu und um Wolfgang Müller von
Königswinter

Das "Rheinweinlied", aber der
Wolfgang-Müller-Text
(W. M. v.
K.)
Wolfgang Müller von Königswinter
Im August 2025 erfasst von Klaus Jans vom
Notenblatt, 16 Seiten,
Verlag N. Simrock, Bonn, 1854, wegen der Zeilen-Wiedergabe im
Gedicht-Stil wurde hier am Anfang immer
groß geschrieben, jede Zeile – im Notenblatt wird es anders
gehandhabt.
|
RHENWEINLIED Originaltext von 1775
RHEINWEINLIED Matthias Claudius
--
gelb
sind die Teile unterlegt, die sich nur hier |
RHEINWEINLIED aber nun die veränderte Text-Version von W. M. v. K. = von Wolfgang
Müller von Königswinter, er fügte einiges
Als Libretto-Text zur Schumann-Ouvertüre, uraufgeführt
am Schumann-Noten wurden zuerst gedruckt 1854 bei N.
Simrock.
-- farbig
(blau/orange/rosa)
sind die Teile unterlegt,
die
sich links |
|
_________________________________
Die
Matthias-Claudius-Strophen
HIER
|
TENORSOLO:
Was lockt so süß! Im lauten Töne weben Kehrt stet der alte Klang,
Horcht, horcht, Er will die gold'nen Flügel heben Entfaltend freud'gen Sang
Oft klang er schon an Rebehügeln wider Im hellen Sonnenschein, O stimmet ein, Es gilt ein Lied der Lieder, Stimmt ein: Am Rhein, am Rhein!
CHOR:
Bekränzt mit Laub den lieben, vollen Becher Und trinkt ihn fröhlich leer, Und
trinkt ihn fröhlich leer! In ganz Europia, Ihr Herren Zecher, Ist solch ein Wein nicht mehr, Ist solch ein Wein nicht mehr! Ist solch ein Wein nicht mehr!
VIER SOLOSTIMMEN:
Was lockt so süß Im lauten Töne weben Kehrt stet der alte Klang
Horcht, horcht, Er will die gold'nen Flügel heben Entfaltend freud'gen Sang
Oft klang er schon an Rebehügeln wider Im hellen Sonnenschein, O stimmet ein, Es gilt ein Lied der Lieder, Stimmt ein: Am Rhein, am Rhein
Bekränzt mit Laub den lieben, vollen Becher Und trinkt ihn fröhlich leer, Und trinkt ihn fröhlich leer!
In ganz Europia, Ihr Herren Zecher, Ist solch ein Wein nicht mehr, Ist solch ein Wein nicht mehr! Ist solch ein Wein nicht mehr!
Am
Rhein, am Rhein, da wachsen uns're Reben, Gesegnet sei der Rhein!
Und geben uns diesen Labewein, Und geben uns diesen Labewein!
So trinkt ihn denn Und lasst uns alle Wege Uns freu'n und fröhlich sein, Uns
freu'n und fröhlich sein! Und wüssten wir, Wo Jemand traurig läge, Wir gäben ihm den Wein, Wir gäben ihm den Wein!
_____________________________________________ |

|
Titel des Werks |
Rheinweinlied-Ouverture |
|---|---|
|
Alternativer Titel |
Festival Overture on the "Rheinweinlied"; Fest-Ouverture mit Gesang; über das Rheinweinlied: "Bekränzt mit Laub"; für Orchester und Chor. |
|
Komponist |
Schumann, Robert |
|
Opus- oder Verzeichnisnummer |
Op.123 |
|
Sätze/Abschnitte |
1 |
|
Jahr/Datum der Komposition |
1853 |
|
Erstveröffentlichung |
1854 |
|
Librettist |
Wolfgang Müller von Königswinter (1816–1873) |


| Titel: | Fest-Ouvertüre über das Rheinweinlied |
| Tonart: | C-Dur |
| Entstehungszeit: | 1852-53 |
| Besetzung: | Tenor, Chor (SATB) und Orchester |
| Erstdruck: | Bonn: N. Simrock, 1854, 1855 und 1857 |
| Bemerkung: | 1. Ouvertüre 2. Tenor-Solo: Was lockt so süß? 3. Chor: Bekränzt mit Laub den Lieben |
| Opus: | op. 123: Fest-Ouvertüre über das
Rheinweinlied HK Op. 123: Fest-Ouverture mit Gesang über das Rheinweinlied für Orchester und Chor |

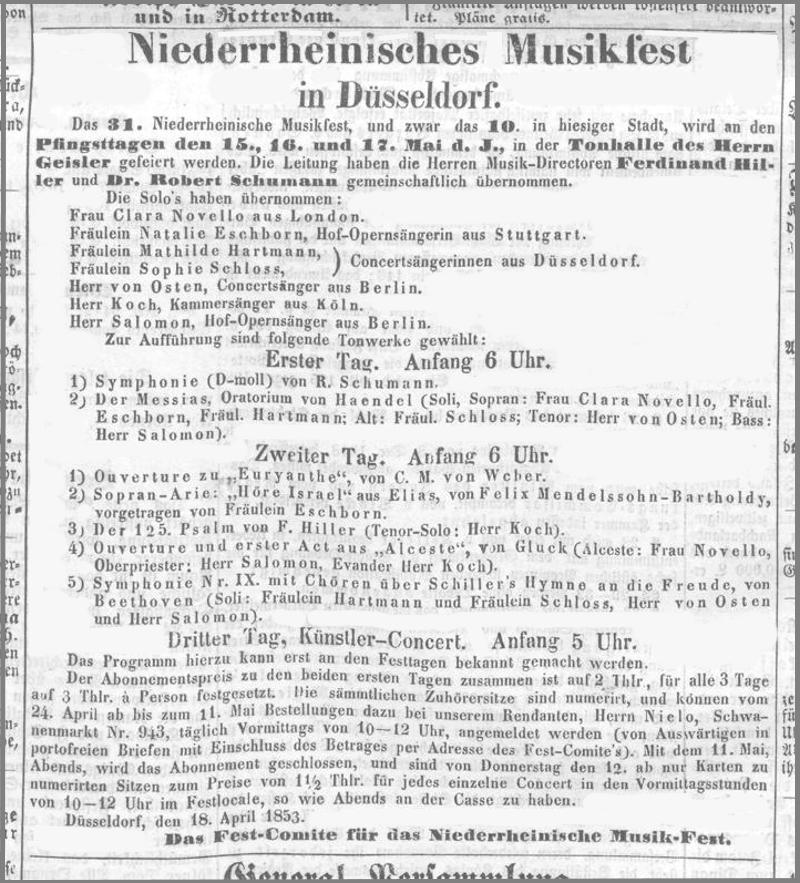

Die "Tonhalle des Herrn
Geisler".
Oder auch: Die Geisler'sche Tonhalle. Aber die neuere! Die von 1852!
### Man
musste in Düsseldorf einst das
Flinger Tor verlassen, um
an Resten der Stadtbefestigung vorbei am Flinger Steinweg einkehren zu
können. Es gab damals dort »Jansens Gartenlokal«. Später hieß dieses
Ausflugsziel »Beckers Garten«. Die Existenz des "Gartens" führte
1818 zur Gründung der »Niederrheinischen Musikfeste« und des
"Städtischen Musikvereins". Im hölzernen Gartensaal wirkten hier
Musikdirektoren mit höchst glanzvollen Namen, von denen Johann August
Burgmüller, Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann nur wenige
sind. Das oft aus beinahe 1.000 Musikliebhabern bestehende Publikum
bezeichnete den Konzertsaal, den auch der 1848 gegründete
Künstlerverein »Malkasten« für seine Maskenfeste nutzte, schon damals
als »Tonhalle«.
1850 übernahm die
Hofkonditorei Geisler das Gartenlokal, das 1863 ins Eigentum der
Stadt Düsseldorf wechselte.
Angesichts der Beliebheit der muskalischen Veranstaltungen im eigenen
Konzertsaal leistete sich die Stadt Düsseldorf im Jahr 1864 als zweite
deutsche Stadt nach Aachen ein eigenes Orchester. Von dieser Zeit an
hieß der die Veranstaltungsstätte auch offiziell »Tonhalle« und
wurde nach und nach um- und weiter
ausgebaut. ###
QUELLE INFO:
www.duessel-aqua.de/vom-gartenlokal-zur-tonhalle,
abgerufen am
27.8.2025, TEXT von K. J. leicht geändert und etwas gekürzt. – Die
Informationen könnten allerdings ursprünglich aus diesem Artikel
herstammen:
>>> Bernhard R. Appel: Geislers
Saal und die
Tonhalle. In: Neue Chorszene. Zeitschrift des Städtischen
Musikvereins zu Düsseldorf e. V. Konzertchor der Landeshauptstadt
Düsseldorf. 16. Jahrgang, Ausgabe 1 (Januar 2012), Seite 34 bis
Seite 42.
Bernhard R. Appel schreibt nämlich in diesem soeben erwähnten
NEUE-CHORSZENE-Beitrag: "1852 wurde in
unmittelbarer
Nachbarschaft des seinerzeit Geislerscher Saal genannten Raumes ein
zweiter, wesentlich größerer
Konzertsaal errichtet, die Tonhalle, die in der einschlägigen Literatur
notorisch mit dem älteren
Geislerschen Saal verwechselt wird." Siehe: Bernhard R. Appel: Geislers Saal und die
Tonhalle. In: Neue Chorszene. Zeitschrift des Städtischen
Musikvereins zu Düsseldorf e. V. Konzertchor der Landeshauptstadt
Düsseldorf. 16. Jahrgang, Ausgabe 1 (Januar 2012), S. 34.
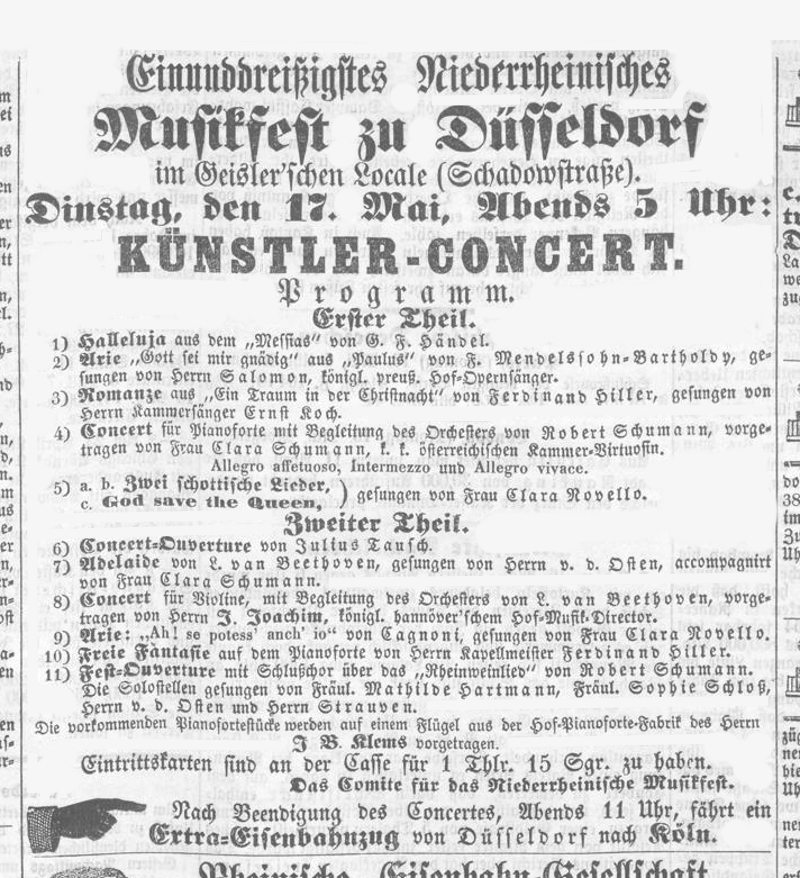

DAS Niederrheinische MUSIKFEST
von 1853 UND DER SAAL IN DER SCHADOWSTRASSE ... IM GARTEN vom
GEISLER'SCHEN LOKAL. -- Hinweis:
Die
Schadowstraße hieß 1851 noch Flinger Steinweg. --
>>>Das 31. Niederrheinische Musikfest, und zwar das 10. in hiesiger Stadt, wird an den Pfingsttagen den 15., 16. und 17. Mai d. J. in der Tonhalle des Herrn Geisler gefeiert werden. Die Leitung haben die Herren Musikdirektoren Ferdinand Hiller und Dr. Robert Schumann gemeinschaftlich übernommen.<<< Zitat aus "Düsseldorfer Journal und Kreisblatt" vom 1.5.1853.
-- Später wurde
allerdings als Dritter in der Leitung auch noch Julius Tausch genannt.
Damals noch eine Art Asssistenz des Düsseldorfer Musikdirektors Robert
Schumann. (Tausch wird die Position von Schumann als Musikdirektor in
Düsseldorf ab Juli 1854 offiziell
einnehmen.)
>>>Der
riesige, in Mitten eines lachenden
Gartens gelegene Concertsaal, wird sich auch vielen andern
Vergnügungen öffnen. Man darf nicht vergessen, daß Düsseldorf
durch eine Malerschule berühmt ist, die gepriesen oder getadelt
immerhin eine bedeutende Rolle in der Geschichte der modernen Kunst
spielt. Wir werden also dort auch eine Gemälde=Ausstellung
finden.<<< Zitat aus dem "Independance Belge", wiedergegeben
im Düsseldorfer Journal und Kreis-Blatt vom Mittwoch, 11. Mai. Der
wiedergegebene Artikel des "Independence Belge"-Artikels ist länger.
Hier geht es jetzt nur um den Aufführungsort. Siehe dann auch noch das
längere Independance-Belge-Zitat etwas weiter unten.
Im Geisler’schen Saal lagen die Zuschauerzahlen im Jahre 1850 bei
nahezu 1000 Besuchern. LAUT QUELLE: Volker
Frech, Lebende Bilder und Musik am Beispiel der Düsseldorfer Kultur,
diplom.de, 1999, ISBN
3-8386-3062-9, welche wiederum Wikipedia, im Wikipedia-Artikel
"Alte
Tonhalle", angibt.
1852 wurde unmittelbar neben dem
Geisler’schen Saal ein neuer,
wesentlich größerer Konzertsaal errichtet, die "Tonhalle". (Das
wäre dann die NEUE GEISLER'SCHE HALLE von 1852 = GEISLER'SCHE HALLE
ZWEI.)
QUELLE: Bernhard R.
Appel: Geislers Saal und die
Tonhalle. In: Neue Chorszene. Zeitschrift des Städtischen
Musikvereins zu Düsseldorf e. V. Konzertchor der Landeshauptstadt
Düsseldorf, 16. Jahrgang, Ausgabe 1 (Januar 2012), S. 34, eine
Quelle, welche
wiederum auch der Wikipedia, Artikel "Alte Tonhalle", angibt. Der DOWNLOAD der PDF-Datei von "Neue Chorszene"
via
https://musikverein-duesseldorf.de/wp-content/uploads/2014/10/NC1_12.pdf
war am 28.8.2025 für K. J. noch möglich.
Diese neu errichtete Halle für das und des Gesangsfestes
von 1852 war
demnach GENAU auch diejenige Halle der
31. Niederrheinischen Musiktage, knapp ein Jahr später, 1853. DER
GEISLER'SCHE HOLZ-NEUBAU von
1852 trug
auch noch 1853 ... und offenbar
bis 1863/1864 noch. Und dann noch mindestens 11 Jahre lang. (Die ALTE
HALLE war offenbar aus Stein.) Man lese folgendes Zitat aus der
"Rheinischen Musik-Zeitung" vom 14.8.1852, es geht um ein Gewitter beim
Gesangsfest August 1852, als es die neue hölzerne große Halle ganz
frisch schon gab (es gab zwei Hallen parallel, das wird hier zu 100 %
deutlich, meint K. J.):
>>>Diese Gartengäste nun flüchteten, da
der Boden binnen fünf Minuten
durch den wolkenbruchartigen Guss überschwemmt wurde, in den Saal
von Stein, der glücklicher Weise neben der Halle von Holz noch zur
Verfügung stand.<<<
In der Zeit vom 24. bis 26. Mai 1863 fand allerdings
zum
letzten
Mal ein Niederrheinisches Musikfest, das vierzigste, in dieser aus Holz erbauten
NEUEN
GEISLER'SCHEN Tonhalle von 1852 statt. Also jene in der Bau-Version von
1852.
Im Oktober 1863 übernahm die STADT DÜSSELDORF die
Halle und begann den Umbau ab 1864: Aus Holz wurde Stein.
"Erweiterungsumbau"
nannte man das. Das wäre dann wohl die erste
TONHALLE im städtischen
Besitz. Diese würde aber erst, so nahm man im
September 1864 jedenfalls noch eher optimistisch an, im Jahr 1865 als
UMBAU fertig. De
facto hat es aber noch bis
mindestens Februar 1866 gedauert, mit dem
Umbau. (Anbei dazu
drei
ZITATE aus zwei Zeitungen und einer Zeitschrift.) – OFFIZIELL wurde die
neue "Städtische Tonhalle" am 6.2.1866 eingeweiht. Ohne Reden, aber mit
Musik.
ZITAT: aus "Kölnische
Zeitung" vom 11.9.1864, von K. J. am 10.9.2025 als offener Online-Text
fürs
Internet erschlossen, die Kursiv-Setzung ist auch von K. J.:
ZITAT:
aus der Zeitschrift "Über Land und Meer" vom Februar 1866, Nr. 22, 15.
Band, 8. Jahrgang, Seite 343, von K. J. am 10.9.2025 als offener
Online-Text
fürs
Internet erschlossen.
ZITAT:
aus "Düsseldorfer Zeitung" vom 8.2.1866, von K. J. am 10.9.2025 als
offener Online-Text
fürs
Internet erschlossen.
Schon am 8.2.1866 und weiter vom 11. bis
13.2.1866 gab es volles Programm in der nun eingeweihten "Städtischen
Tonhalle". Wir sehen gleich eine Anzeige aus der "Düsseldorfer Zeitung"
vom 8.2.1866. Zuerst gibt es die "Redoute" am 8.2.1866 im Ritter- und
Mittelsaale. (Wir merken: mehrere Säle existieren!) Der
Maskenball vom 11.2.1866 oder vom 12.2.1866 oder vom 13.2.1866
findet "in allen Sälen" statt. Also vermutlich mindestens drei Säle
existent. Explizit wird aber verwiesen: "unter Benutzung des neuen
großen
Saales", sodass wir vermuten; durch die Umbauarbeiten ab 1864 entstand
ein (ganz) neuer Saal oder zumindest ein vollkommen erneuerter
Saal.
K. J. hat diese Anzeige hier unten am 11.9.2025
erschlossen und als 800-Pixel-jpg-Bild in diese Homepage-Seite
eingebaut.


Zurück zu 1852 und 1853 und noch davor, noch vor dem ganz großen
Super-Umbau
der Jahre 1864 bis 1866: Es geschahen jedenfalls solcherlei
Musik-Ereignisse allesamt in einer
(immer nachdenken: welcher?) Halle
im
Geisler'schen Garten in Düsseldorf. Der Garten hatte vorher andere
Namen, weil
andere Gastwirte (Jansen oder Becker) das Garten-Lokal besessen hatten.
Aber unter Geisler im Jahr 1852 gab es einen Neubau der vorher schon
dort stehenden Halle. Bzw. zusätzlich
zu vorher dort schon stehenden
Halle.
Erschaffen extra für das
Düsseldorfer Sing-Ereignis des Jahres 1852: das 4-tägige Gesangsfest im
August. Man hatte so mehr Platz in der/einer (neuen) Halle.
Ab 1852, spätestens fertig wohl
Anfang August 1852, eben wegen des Gesangsfestes, gab es eine
fertiggestellte neuere Geisler-sche Halle
als diejenige, die man bislang bei GEISLER im Garten benutzte. Diese
nun folgende Anzeige (von K. J. seitlich mit blauen Streifen markiert)
zum Düsseldorfer "Großen Gesang-Fest" vom 1.8. bis 4.8.1852 fand K. J.
in der "Düsseldorfer Zeitung" vom 31.7.1852 und hat sie hier auf 800
Pixel ganz leicht verkleinert und am 11.9.2025 auf dieser Hompage
eingestellt. – Wir lesen z. B. "Großes Gesang-Fest" und
"Gesang-Wettstreit, Compositionskampf, Concert und Künstler-Fest". Wo?
"Tonhalle im Geisler'schen Garten", welche natürlich der NEUBAU von
1852 war. Ist doch logisch. Es kann nur die neuere sein. – Es gab
auch noch ein großes Vocal- und
Instrumental-Concert am 3.8.1852, Schumann dirigierte. Zusätzlich dazu
und zusätzlich zu den Wettstreiten gab es auch noch ein
"Künstler-Fest", veranstaltet vom (heute noch existenten)
Künstlerverein namens "Malkasten".
Also 4 Tage, wo die NEUE GEISLER-SCHE HALLE total "bespielt" und
genutzt wurde. Und es sollten ja etliche Personen anreisen, allein ...
um an den Wettstreiten teilzunehmen.
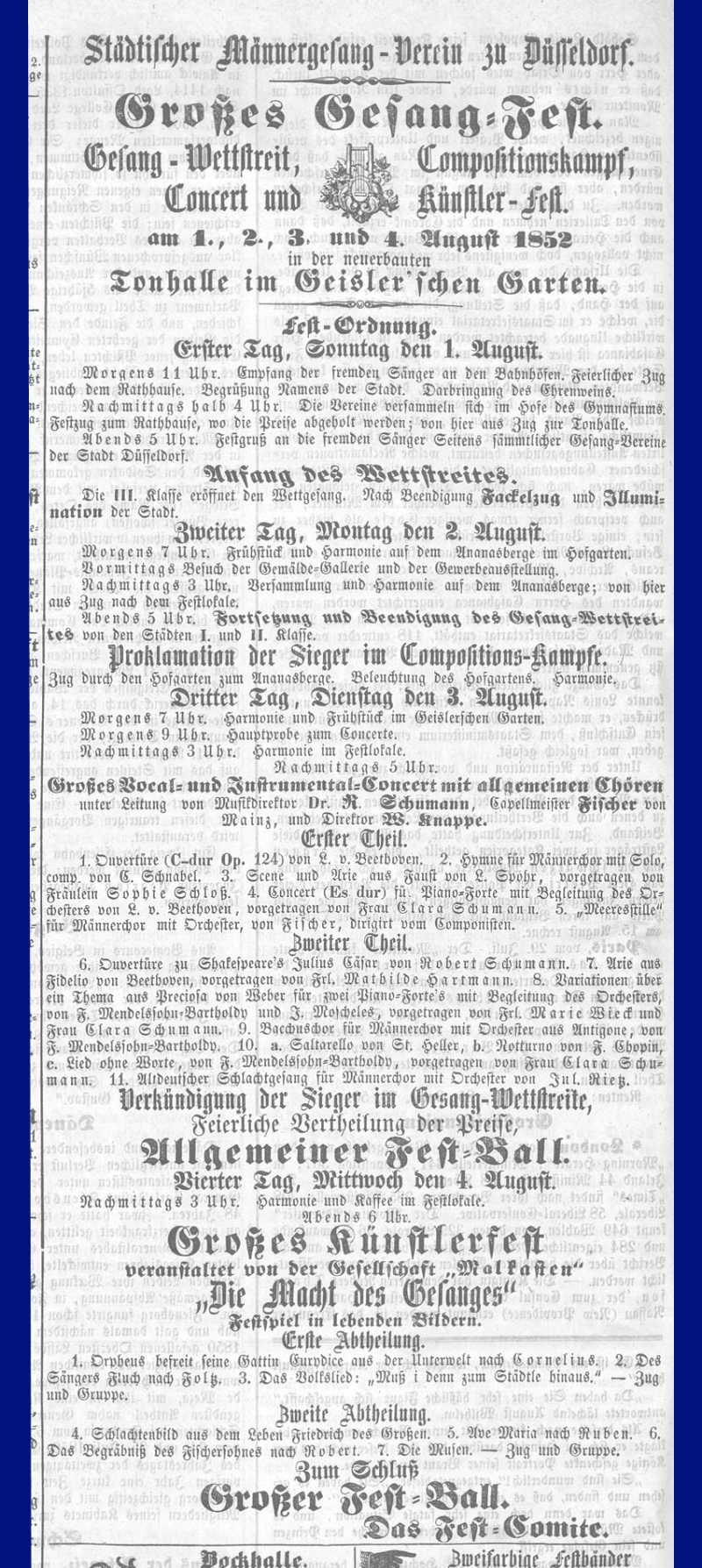
-- QUELLE für diese ANZEIGE:
Düsseldorfer Zeitung vom 31.7.1852. --
ES FOLGT EIN BERICHT BZW. EINE
SEHR KRITISCHE BEWERTUNG ZUM GESANG(s)FEST in DÜSSELDORF in der
Geislerschen (nagel)neuen Tonhalle = HALLE 2 in Geislers Garten, wo/was
ja auch das bekannte Garten-Local des Herrn Geisler war.
– Vom 1. bis 4. August 1852 war dieses Gesangsfest. (Ohne s war
aber damals die übliche Schreibweise. Wir würden es heute eher mit s
schreiben, analog zu Arbeitsamt.)
K. J. hat diesen Artikel samt
Zeitungskopf als
JPG-Bild am 12.9.2025 als offenen Internet-Text in diese Web-Seite hier
hineingestellt.

QUELLE: "Rheinische
Musik-Zeitung für Kunstfreunde und Künstler"
-- herausgegeben von
Professor L. Bischoff
Nro. 111. Cöln, den 14. August 1852. III. Jahrg. Nro. 7.
Von dieser Zeitung erscheint jeden Samstag wenigstens ein ganzer Bogen. – Der Abonnements-Preis pro Jahr beträgt 4 Thlr. Durch die Post bezogen 4 Thlr. 10 Sgr. Eine einzelne Nummer 4 Sgr. – Insertions-Gebühren pro Petit-Zeile 2 Sgr. – Briefe und Packete werden unter der Adresse des Verlegers M. Schloss in Cöln erbeten.
HIER: Seiten 881 bis 884, übers Jahr wurde fortlaufend paginiert –
Seite 881 = TITELSEITE dieser Ausgabe. Originaler
Das Gesangfest in
Düsseldorf.
Das Düsseldorfer Fest, dessen Programm den pomphaften Titel führte:
„Grosses Gesangfest,
Gesang-Wettstreit, Compositionskampf,
Concert und grosses Künstlerfest“, und zu dessen Feier, wie
einst
zu den olympischen Spielen alle Hellenen, so die Deutschen „aus
allen Gauen vom blauen (P) Rhein bis an das tiefe Meer und bis an die
Alpenhäupter“, und die Brüder aus dem „Schwesterland am
Meer mit seinen beiden Reichen“ laut dem Festliede berufen waren,
ist an den ersten vier Tagen des Augustmondes gefeiert worden. Dass
an dem grossen Kampfe sich von Deutschland hauptsächlich nur
der Gau (vulgo
Regierungsbezirk) Düsseldorf, von Holland und
Belgien aber Niemand, betheiligte, dass 10 Vereine aus
Städtchen, 6 aus kleinen Städten und nur 4 aus grössern
Städten (Bonn „Concordia“, Köln „Bürger- und
Handwerker-Verein“ und „Polyhymnia“, Elberfeld „Orpheus“)
um die Preise sangen, daran waren auf keinen Fall Aufruf und
Ankündigung Schuld. Eben so wenig konnten die Festrufer dafür, dass
die neun (!) Richter im
Gesangwettstreit, unter denen musikalische
Grössen wie F. Hiller und Rob. Schumann glänzten, sich mit so
viel Kleinem beschäftigen
mussten. Ausser den genannten, von denen
Hiller sogar von London bloss zu diesem Zweck herübergeschifft war,
waren vom Norden C. A. Bertelsmann
aus Amsterdam, vom Osten G.
Reichardt (der Componist des Arndt'schen Liedes) aus Berlin, vom
Süden F. Messer aus Frankfurt
a. M., Capellmeister Fischer
und
„Componist“ Beyer (quid Saul inter prophetas?) aus
Mainz
herbeigeladen, um die Herren Schumann,
Tausch und Knappe in
Düsseldorf mit ihrem kritischen Ohr zu unterstützen.
Dagegen war
eine grosse Schaar von Besuchenden,
und diese in der That aus
allen Gegenden von Deutschland, herbeigeströmt und dies gab
neben dem äussern Glanz, welcher in Ausschmückung des
Festlokals, Erleuchtung, Feuerwerk u. s. w. wahrhaft imposant war,
dem Ganzen einen heitern und festlichen Charakter, an dem man
sich recht erfreuen und über die Geringfügigkeit der
musikalisch-künstlerischen Bedeutung des Festes trösten
konnte. Freilich, wer an derselben Stelle so manche Jahre lang die
niederrheinischen Musikfeste mitgemacht hatte, wer die
Begeisterung gesehen, welche die herrlichen Aufführungen der grossen
Meisterwerke hervorriefen, wer es erlebt, wie die Musiker und
Musikfreunde nach ihren Wohnorten zwar nicht mit Pokalen und Römern,
aber mit gehobenem, frisch belebtem Sinn und Herzen für die
göttliche Tonkunst zurück kehrten, wer den geistigen Aufschwung
getheilt, der Alles emporzog in die wahren Regionen der Kunst,
wenn Händels gewaltige Chöre die Adlerschwingen entfalteten,
Beethoven's Sinfonien wie Gewitterstürme daherrauschten oder wie
majestätische Ströme dahin zogen, wer daran dachte, dass hier
an derselben Stelle die Wiege der rheinischen Musikfeste stand, dass
hier Mendelssohn sein grösstes Werk dichtete, dass die Chöre
des Paulus zuerst in jenem Saale da erklangen und von hier aus den
Wiederhall durch Europa fanden – wer daran
sich erinnerte, der
wandelte kopfschüttelnd unter den Bäumen auf und ab, gar sonderbare
Gefühle stiegen in ihm auf, wenn er nicht den zum Himmel sich
aufschwingenden Klang jugendlicher Frauenstimmen, sondern nur ein
monotones Geschwirr von tiefen Tönen vernahm, und Zeuge sein musste,
wie nicht die
Volksstimme des Publikums einem Händel, Beethoven, Mendelssohn
zujauchzte, sondern neun Männer zu Gericht sassen über Kücken,
Otto, Stöppler, Abt, Härtel, Neithardt, Häser und Herx! Bei so
bewandten Umständen konnte selbst die frohe Nachricht, dass im
Malkasten an dem einen Nachmittage fünf Ohm baierischen Biers
ausgetrunken worden, den Sinnenden nicht aus seinen melancholischen
Erinnerungen reissen.
Woher kam es denn nun aber, dass mit Ausnahme
der Liedertafel Concordia von Bonn, (welche sich indess auch erst
vier Wochen vor dem Feste auf besondere persönliche Einladung eines
Mitglieds des Düsseldorfer Comité's dazu entschloss) keiner
der grössern mit Recht berühmten rhein. Gesangvereine sich
eingefunden hatte? Warum entsagten Gesellschaften, wie der
Männer-Gesangverein von Köln, die Vereine von Aachen und Crefeld,
die Liedertafeln von Elberfeld, Koblenz, Mainz, Frankfurt a. M.
u. s. w. der Theilnahme?
Antwort – weil sie aller derartigen
Feste überdrüssig sind, weil sie namentlich die Wettstreite
nicht bloss für sehr überflüssig, sondern für nachtheilig
und störend und jedenfalls der Kunst, namentlich in
Deutschland, für unwürdig halten. Und darin geben wir ihnen
vollkommen Recht. Wir haben nichts gegen den Männergesang an sich;
aber er bleibe in seiner Sphäre. Auch wir halten ihn für ein
treffliches Mittel, den Sinn für Musik im Wolke zu wecken, und weit
entfernt, die Vereine aus den kleinern Orten und Gemeinden, oder
aus den mittlern und untern Ständen über die Schulter anzusehen,
freuen wir uns immer, sobald wir von einer wachsenden
Verbreitung derselben im Waterlande hören. Aber um die Fortschritte
derselben im Gesang zu constatiren, besondere Feste zu veranstalten,
denen man eine künstlerische Bedeutung beimessen will, vollends
Preise auszusetzen und diese untergeordnete Kunstgattung zu
einer Wichtigkeit emporzuschrauben, die sie nicht hat und nie
haben wird, Wettstreite auszuschreiben, welche die Eintracht nicht
etwa befördern, sondern stören und alles freudige
Zusammenwirken hindern, welche die grossen Gesammtaufführungen, die
allein noch einigen künstlerischen Werth haben könnten, zur
Nebensache und das Singen meist unmännlicher Texte und Melodien
zur Hauptsache machen, wodurch der Geschmack des Volks verdorben
und die Liebe zur Kunst in den
Vereinen selbst ertödtet wird, weil
diese der Preise halber sich auf eine gewisse Virtuosität des
Vortrags legen, wobei ihnen der Compositionswerth der gewählten
Stückchen ganz gleichgültig ist; endlich um solche Wettstreite zu
schlichten, Männer zu bemühen, die für die Kunst ganz andere
Aufgaben zu lösen haben, als zu bestimmen, ob die Zwanzig von
Stolpe oder die Zwölfe von Buxtehude pokalwürdiger gesungen haben –
das ist jedenfalls trop de bruit
pour une omelette und hat mit der
Förderung der Kunst gar nichts zu schaffen, ja es ist der wahren
Kunst geradezu verderblich. Selbst die beste Seite dieser Feste,
die gesellige, wird durch die Wettstreite zu einer schlechten
verkehrt. Statt der Eintracht, ersingt man Zwietracht, die nicht
bloss das Fest stört, sondern sich oft noch Jahre hinaus durch alle
Verhältnisse fortspinnt. Uns fällt immer dabei die naive
Bemerkung Bettinens an Göthe ein, welche sie über die
Künstlereifersucht der damaligen musikalischen Grössen in
Berlin macht: „Sie fallen alle über einander her, Zelter über
Reichard, dieser über Hummel, dieser über Righini und der wieder
über den Zelter; es könnte ein Jeder
sich selbst ausprügeln, so
hätte er immer den Andern einen grössern Gefallen geth an, als
wenn er ihn zum Concert eingeladen hätte“.
Und was soll uns
überhaupt in Deutschland dieser französische Eitelkeitskram?
Hören wir doch, was bei Gelegenheit des Gesangwettstreites in Lille
eine Stimme aus Belgien, der ursprünglichen Heimath jener
Wettkämpfe, über das Düsseldorfer Fest im Voraus sagt: vielleicht
wirkt ein vernünftiges Wort aus dem Auslande noch besser, als die
Warnungen der Landsleute. Es heisst in einem Briefe aus Brüssel
vom 1. Juli an den Herausgeber der Pariser Revue musicale *).
„Ich
muss damit anfangen, Ihnen für die Artigkeit zu danken, mit welcher
Sie meine Landsleute in ihrem Bericht über das Sängerfest in Lille
behandelt haben, wo sie allerdings sehr schmeichelhafte Erfolge
errungen haben. Zwei belgische Städte, Gent und Lüttich, ja zwei
ganze Provinzen sind in die grösste Aufregung gerathen. Der
Begeisterungsrausch der Bevölkerung von Gent bei der Rückkehr
ihrer Société des Choeurs,
welche einen ersten Preis gleich dem der
Aachener Sänger erhalten, lässt sich nur mit dem wahnsinnigen
Entzücken vergleichen, welches die Lütticher bei der Nachricht
ergriff, dass ihr „Orpheus“ über die Mainzer Liedertafel gesiegt
habe. Nach beiden Städten brachte der elektrische
*) Nr.
27 vom 4.
Juli d. J.
Telegraph die Nachricht von dem National- oder
richtiger
Communalsieg: die Geschäfte stehen still, es ist von nichts die
Rede, als von den Vorbereitungen zum Empfange der Sänger. Die
Behörden greifen ein, man veranstaltet Processionen, um denen
entgegen zu ziehen, welche den Ruhm ihrer Stadt so glorreich
behauptet haben, die Glocken läuten, die Kanonen donnern, Lebehochs
steigen in die Luft – es fehlt nicht an Ehrenwein mit
Accompagnement officieller Redensarten. Hätten sie Paris mit
Sturm genommen, man könnte ihnen keinen glänzendern Triumph
zuerkennen.
Wahrlich, mein Verehrtester, Sie sind die
Ehrlichkeit
selbst, dass sie gestehen, dass die ausländischen Vereine den
französischen überlegen sind! Ha, wären Sie von Gent oder
Lüttich [vielleicht auch von Aachen, Cöln, Bonn oder Düsseldorf
und man hätte ihre Mitbürger nicht gekrönt, so würden Sie über
die Jury herfallen, Sie würden sie parteiisch und ungerecht nennen,
Sie würden rasen und toben und alle öffentlichen Blätter mit ihren
Reclamationen füllen. Auf einem Schlachtfeld kann man besiegt
werden, das gesteht man allenfalls ein: aber bei einem
Gesangwettstreit? Nimmermehr! Das kann nie mit rechten Dingen
zugegangen sein!
Bei unsern Brüsseler Wettstreiten habe ich vor
einigen Jahren gesehen, wie man einen deutschen Verein auf der
Strasse auspfiff und verhöhnte, weil – er den ersten Preis über
die belgischen Gesellschaften davongetragen hatte. Ja, in
Nationaleitelkeit und Concursangelegenheiten verstehen wir
keinen Spass!
Aus den deutschen Zeitungen ersehen wir, dass am
1. August in Düsseldorf ein
Gesangwettstreit, wie sie in Belgien
Sitte sind, stattfinden soll. Das wird vielleicht für die
Rheinprovinz etwas Neues sein, aber
wahrlich kein Fortschritt. Bei
solchen Wettstreiten spielt die eigentliche Musik nur eine sehr
unbedeutende Nebenrolle. Die Eigenliebe des Einzelnen, die
Collectiv-Eitelkeit, der Lokalstolz kommen dabei vor allem ins
Spiel. Mit Bedauern würde ich es sehen, wenn diese heterogenen,
schmarotzer pflanzenartigen, zerstören den Elemente sich in die
deutschen Musikfeste ein drängten, wo einst die reine Liebe zur
Kunst alle in waltete. Fand Wetteifer statt, suchte man die
Nachbarstadt zu übertreffen, so geschah es nur um Meisterwerke
der Tonkunst desto würdiger aufzuführen. Versammelte man ein
Tausend Mitwirkende, so geschah es zu einer Gesammtleistung. Und
jetzt will man sie abtheilungsweise zu dreissig oder vierzig hören
lassen? Ist das ein
Fortschritt? In Belgien haben die Gesangwettstreite das Gute
gehabt, den Eifer der Singvereine zu reizen und die Entwickelung
dieser Gattung von Musik zu fördern. Derselbe Zwek kann durch
ähnliche Mittel auch in Frankreich erreicht werden. Aber Deutschland
steht nicht auf solchem Standpunkte: der Chorgesang ist da eine alte,
in vollem Gedeihen befindliche Einrichtung, die man nur sich selbst
zu überlassen braucht!“
So weit die Stimme des Ausländers, die
des Beherzigenswerthen gar vieles enthält, wie das
Düsseldorfer Fest von neuem bewiesen. Die einzelnen Gesänge
waren meist langweilig, theils durch die Wahl mancher faden
Compositionen, theils durch den mangelhaften Vortrag; nur die Hälfte
der auftretenden Vereine konnte einigermaassen künstlerischen
Forderungen genügen, im Grunde aber nur die von Bonn und Neuss,
obgleich die beiden Kölner Vereine schöne Kräfte hatten. Die
Gesammtchöre in dem Concert am dritten Tag gingen nichts weniger als
vorzüglich, an eigentliche Präcision war dabei nicht zu denken –
sie wurden als Nebensache behandelt. Nur Fischer's „Meeresstille
und glückliche Fahrt“, von dem Componisten selbst dirigirt, war
eine gelungene Aufführung und die frische und leicht fassliche
Composition machte auch hier, wie schon bei so manchen Sängerfesten,
ihre Wirkung und wurde da capo
gerufen.
Man schien im Festcomité
gefühlt zu haben, dass der blosse Männergesang die Gäste nicht
drei Tage lang fesseln würde, und so hatte man für den dritten
Tag ein „grosses Vocal- und Instrumentalconcert mit allgemeinen
Chören“ angesetzt und dazu die in Düsseldorf vorhandenen
Künstlerkräfte in Anspruch genommen. So vortrefflich diese nun auch
allerdings sind, denn es traten Frau Clara
Schumann nebst ihrer
Schwester Frl. Maria Wieck,
jene mit Beethoven's Es dur-Concert,
dem
Saltarello von St. Heller, Notturno von Chopin und einem Lied ohne
Worte von Mendelssohn, diese im Verein mit ihrer Schwester in den
Variationen von J. Moscheles und F. Mendelssohn über ein Thema aus
Weber's Preziosa für 2 Flügel, – ferner Frl. S. Schloss mit
der grossen Scene und Arie aus Spohr's Faust, Frl. Hartmann mit der
Arie aus Fidelio auf – so war doch das Ganze durchaus nicht
befriedigend und dem Standpunkte eines grossen Musikfestes nicht
angemessen. Es trafen freilich mehrere Umstände zusammen, um den
Erfolg zu vereiteln, sogar ein sehr starker Regenguss, der in das
Publikum einige Unruhe brachte und durch das Geräusch der Tropfen, die
auf die
Bretter und die Glasdecke der Tonhalle fielen, ein sehr widriges
Accompagnement bildete. Allein die Hauptschuld trug der Mangel an
Akustik in der übrigens recht schönen und geschmackvoll verzierten,
neu erbauten Halle, und zweitens die unverantwortlich schwache
Besetzung des Orchesters. Dadurch ging die Wirkung der beiden
Ouvertüren, von Beethoven in C. Op. 124. und von R.Schumann zu
Shakespeare's Julius Cäsar, ganz verloren; in dem Beethoven'schen Es
dur-Concerte blieben eine Menge Stellen undeutlich, weil man die
Solostimmen im Orchester nicht hörte, ja es entstanden für die
Zuhörer in der hintern Hälfte der Halle förmliche Pausen, weil man
z. B. bei der Einleitung zum Wiedereintritt der Accorde mit den
Cadenzen in der Mitte des ersten Satzes von der Figur der Bratschen
und zweiten Violinen geradezu gar nichts vernahm. So herrlich, so
ächt künstlerisch und wahrhaft ergreifend auch Frau Schumann
das gewaltige Werk Beethoven's in der Probe vortrug, so war es doch
in der Aufführung, wo die Hälfte des Publikums mit grosser
Anstrengung nur Fragmente desselben hörte, nicht möglich den
Enthusiasmus zu erregen, welchen die grosse Künstlerin sonst
unzweifelhaft hervorgerufen haben würde. Auch die Wirkung der
Arien litt, jedoch in geringerm Maasse, durch die angeführten
Uebelstände. Ueber die Schumann'sche Ouvertüre zu Julius Cäsar
wollen wir bei so bewandten Umständen nicht absprechen, da wir
sie in der Probe nur stückweise, in der Aufführung sehr häufig
nicht viel mehr von ihr als die Posaunen und Trompeten vernahmen: so
viel indessen schien uns aus der Anhörung hervorzugehen, dass wenn
Schumann in dieser Richtung noch einen Schritt weiter geht, in
seinen Compositionen alsdann an die Stelle der Musik ein formloses
Tongewühl tritt, welches weder Verstand noch Gefühl befriedigen
kann.
Ein Nachspiel, gleichsam ein Drama satyricum nach der Trilogie
der Tragödie, veranlasste am 2. Tag der Aufruf der Gesellschaft
„Malkasten“. Es galt, nach dem Schluss der Gesänge einen neuen
Wettstreit zu beginnen um ein Gemälde, welches von „Preisrichtern,
die nicht musikalisch wären“, demjenigen Verein zuerkannt werden
sollte, welcher auswendig das beste komische
Lied singen würde. Der
Scherz wurde in der That ausgeführt, 4 oder 5 Vereine suchten sich
durch allerlei Gesangfaxen zu überbieten, es wurde vortrefflich
gemäckert, ge-yat [SIC! ge-yat !!!
K. J.] u. s. w. – Das ganze war eine, wir wissen nicht
ob bewusste oder unbewusste, jedenfalls aber köstliche Ironie
auf den hohen Ernst des vorhergegangenen welthistorischen
Kampfes.
Ein recht gemüthliches Intermezzo führte auch noch Jupiter
Pluvius am Dinstag herbei. Es waren nämlich zu dem Concert an
5–600 Karten mehr ausgegeben, als die Halle Personen fasste,
worüber wir gerade nicht so arg, wie das von Andern geschehen,
mit dem Comité rechten wollen. Es gibt Leute genug, die gern ihr
Eintrittsgeld zahlen, um nur in dem schönen Garten zu sitzen und
sich, wie sie sagen, den Trödel mit anzusehen: warum soll das Comité
ihnen dies Vergnügen versagen? Wer da weiss, was solche Feste für
Geld kosten – (und Düsseldorf hat wahrhaftig keine Kosten
gescheut, um seine Gäste zu befriedigen), der wird es mit
dergleichen Dingen nicht so streng nehmen – vorausgesetzt dass
die Sache nicht übertrieben und dadurch rein zur Speculation wird.
Diese Gartengäste nun flüchteten, da der Boden binnen fünf Minuten
durch den wolkenbruchartigen Guss überschwemmt wurde, in den Saal
von Stein, der glücklicher Weise neben der Halle von Holz noch zur
Verfügung stand. Tische, Stühle, Bänke wurden herbeigeschafft
und man improvisirte einen Salon, der von zahlreicher Gesellschaft
von Damen und Herren besucht war und in den dann und wann ein Tutti
aus der Tonhalle schwach herüber tönte. Nicht lange und es erschien
ein Musikcorps mit Blech und begann nach Herzenslust Polka's und
Schottisch u. s. w. zu blasen. Einige Augenblicke später stellte
sich auch die Gesanglust ein, man stimmte Lieder an, unter
andern „das deutsche Vaterland“, welches der Componist, der auch
nicht in die Tonhalle hatte eindringen können, nolens volens
dirigiren musste, und erlustigte sich auf eigne Hand, während drüben
im Brettersaal der ernsten Muse der Tonkunst gehuldigt wurde. Ob das
Comité oder der Wirth die Aufmerksamkeit gehabt hatte, die
Blechmusik zu besorgen, weiss ich nicht: aber umsonst hat die
Gesellschaft sie gehabt. Was will man mehr?
Dem „Künstlerfest“,
(unter „Künstler“ versteht man nämlich in Düsseldorf
bloss die Maler) das für den dritten Tag von der Gesellschaft
Malkasten angekündigt war, konnten wir wegen Mangel an Zeit
nicht beiwohnen. Leider hat es zu verdriesslichen Auftritten und
noch verdriesslichern Erörterungen derselben Veranlassung
gegeben. Wir haben über die Sache selbst kein Urtheil, da wir nicht
mehr zugegen waren; auch geht sie eine musikalische Zeitschrift
nichts an. Allein als Vertreter der Sänger,
namentlich der
auswärtigen, müssen wir doch
in Bezug auf die Erklärung des Vorstandes
des Malkastens
in Nro. 196 der Kölnischen Zeitung, wonach „1700 Sängerkarten
gegen Einlasskarten zum Künstlerfest ausgetauscht worden sind“,
bemerken, dass nach der gedruckten Liste Theil nahmen: 1)
Concurrirende Sänger 638. 2) Deputirte von verschiedenen Vereinen
361. Summa der fremden Sänger 999. Dazu 3) Düsseldorfer Sänger
410. Summa der Sänger im Ganzen 1409. Gesetzt, diese im Textbuch
verzeichneten Sänger wären alle zugegen gewesen, was nicht der
Fall war; gesetzt ferner, sie wären alle zum vierten Tag anwesend
geblieben, was notorisch noch
weniger stattfand, so hätten
doch
immer in ihren Händen nur
1409 Karten sein können. Die 300 mehr
müssen also nothwendig entweder aus ungesetzlicher Verausgabung
an Nicht sänger von Seiten des Comité's, oder aus einer
Nachdrucksfabrik herrühren, deren Betrieb kein Vernünftiger den
fremden Sängern in die Schuh schieben wird. Diese Bemerkung hier
aufzunehmen, waren wir den Festtheilnehmern, die uns darum
ersuchten, schuldig, um sie gründlich gegen den in der
gedachten Erklärung sehr allgemein ausgesprochenen Vorwurf des
„Unterschleifs, der mit diesen Karten getrieben worden“, zu
vertheidigen.
::: ENDE ARTIKEL aus der RHEINISCHEN MUSIK-ZEITUNG
14.8.1852. :::

Und
später dann, ab 1864, auch das ist
wichtig, wurde diese einst einmal "Neue
Geisler-sche Halle" (ja, der neue Bau von 1852) als "Städtische Tonhalle",
Besitzerwechsel also, die Stadt!, Umbaurenovierung bis 1866,
neu geboren und vorher schon so annonciert – die Konzerte nämlich, man
sehe z. B.
am
1.1.1864 in der "Düsseldorfer Zeitung" eine Anzeige für ein Konzert in
der "Städtischen Tonhalle". Das "Städtisch" darf also nicht übersehen
werden! "Tonhalle" allein wäre nach der Übernahme durch die Stadt
(offiziell im Herbst 1863) zu
wenig.
Der GEISLER-SCHE NEUBAU von
1852 wurde 1864 bis 1866 vom NEUEN BESITZER
STADT DÜSSELDORF erneuert:
Also einstmals Neues, 1852, wurde ab 1864 nochmals neu gemacht,
umgebaut,
irgendwie letztlich ja auch (etwas daran) neugebaut.
STEIN ersetzte das HOLZ. Und die STADT DÜSSELDORF war (bereits seit
1863) offiziell der Betreiber der Tonhalle. Nicht mehr der Gastronom
Geisler. Deshalb auch "Städtische Tonhalle".
Wir resümieren: Es gab 1852 bereits zwei Hallen (eine alte wohl
steinerne und kleinere, eine neue aus Holz erbaute und größere)
im Geisler'schen
Garten, man
müsste von beiden Hallen bzw. vom KOMBI-zwei-Hallen-Bau-Komplex eine
Abbildung finden. Das wäre gut.
Die NEUE HALLE bei
GEISLER
im Garten des Garten-Locals wurde 1852 gebaut. (Oder wurden eine ALTE
HALLE und eine NEUE
ANBAUHALLE zu EINER gesamtneuen HALLE fusioniert?) – Denn:
Baue an eine alte
Halle an und erzeuge/erschaffe so eine NEUE Groß-Halle! Lief es so ab?
1852?
OFFENBAR UNGEFÄHR SO JA! – Es gab 1852 zumindest einen Anbau
der neueren Halle an die bereits
existente Halle. Optisch am Ende vielleicht ein Baukomplex, aber dennoch zwei
HALLEN zugleich,
zwei Säle. So wird man es sich wohl vorstellen müssen, bis man ein
(Ab)Bild findet. Eine Zeichnung. Oder sogar ein feines farbiges Gemälde
von der
NEUHALLENKOMBI aus der Düsseldorfer
Schule.
Es blieben irgendwie zwei Hallen parallel existent. Beide waren
aneinandergebaut, zugleich aber dabei immer noch zwei eigenständige
Hallen. Die eine war die ALTE, aus STEIN. Die andere war die größere
NEUE, aus Holz. – So folgert derzeit K. J.
anhand der Infos, die es gibt. (Dazu auch weiter unten noch mehr
Angaben.)

Man kennt eine Abbildung des (ersten?
zweiten? JA, offensichtlich des
zweiten! Des neuen!)
Geisler-schen Saales
von 1852,
allerdings ohne, dass Quelle und Künstler des Stiches genannt werden.
Und
zwar geht es um diese Zeichnung hier. VERMUTLICH ist es die NEUERE
GEISLER'SCHE
HALLE. Diejenige, die 1852 erst erbaut wurde, aus Holz, und zwar
angebaut wurde
.... an die ALTE
GEISLER'SCHE HALLE aus Stein.

In diesem Saal, aus Holz erbaut, von 1852 ff. könnte (( folgt man den
Angaben aus dem
Artikel von Bernhard R. Appel: Geislers
Saal und die
Tonhalle. In: Neue Chorszene. Siehe weiter oben. )) ... und SOLLTE, so denkt K.
J., logischerweise auch das
31.
Niederrheinische Musikfest von 1853 stattgefunden haben. Denn wenn man
1852 neu baute, wird man nicht 1853 nochmals neu gebaut haben, vermutet
K.
J.
Jedenfalls wurde ja laut Bernhard R. Appel eine weitere, neuere HALLE
alias
TONHALLE,
und zwar 1852 ... neben die bereits stehende gebaut.
Es müssten also zwei
Hallen nebeneinander bzw. aneinander gestanden haben. Dort im
Ausflugslokal
Geisler.
ZWEI HALLEN = ALTE HALLE (Stein) und NEUE GROSSE
HALLE (Holz).
Aber welche Abbildung
zeigt welche Halle? ODER GAB ES OPTISCH EINE NEUE FUSIONSHALLE aus Alt und
Neu? Eine Kombi-Halle vielleicht?
Oder doch zwei einzeln noch als solche
erkennbare Hallen, die
lediglich aneinandergebaut waren?
Letzteres scheint der Fall: 1852 wurde eine
neue Halle aus Holz an eine schon vorhandene angebaut. Aber wie sah das
Resultat von außen aus?
Man dürfte dann für das 31. Niederrheinische Musikfest 1853
(Düsseldorf, über Pfingsten) wieder diese neuere GEISLER'SCHE
= "HALLE ZWEI" von 1852 (?) genommen haben, so wäre ganz sicher
anzunehmen. Wegen der Größe.
(Aber: Die Akustik in der NEUEN HOLZ-HALLE war offenbar gar nicht so
gut.)
K. J. hat diese
obige Abbildung zur GEISLER'SCHEN HALLE EINS oder ZWEI (welche ist es?
OFFENSICHTLICH DIE NEUERE HALLE ZWEI! AUS HOLZ.)
auch tatsächlich gefunden: Leider wurde bei Wikipedia bzw. Wikimedia
Commons keine "echte" Quelle
zum Bildnis (Zeichnung, Stahlstich) angegeben. Sehr, sehr vermutlich
handelt es sich aber genau um HALLE ZWEI, die NEUE(RE), ja ... die von
1852. Die Unterzeile Text als Teil der Zeichnung deutet darauf hin. 3.
August (1852). Preise werden überreicht. Gesang(s)fest 1852, Düsseldorf.
Der bei Wikimedia Commons
Hochladende hat das Bild seinerseits aber hier entdeckt:
https://josephjoachim.com/2019/06/01/the-31st-lower-rhine-music-festival/.
Aber auch da, bei der josephjoachim-Webseite steht
kein Wort, wer das Bild / die
Urzeichnung und danach den
Stahlstich erstellt hat. Es gibt auch keine Fundquelle.
WIKIMEDIA COMMONS und josephjoachim.com bringen uns
leider
zur Fundquelle für das Bild/Zeichnung der NEUEN HALLE nicht weiter.
Aber Bernhard R. Appel brachte uns weiter. In seinem
Artikel für die NEUE CHORSZENE, Januar 2012.
:::
Die bedeutende Bild-Quelle zu der bekannten HALLEN-ZEICHNUNG
Geisler-sche Tonhalle (Neubau 1852) ist
eindeutig klar: Dank an Herrn Bernhard R. Appel. :::
K. J. hat das Hallen-Bild von Wikimedia Commons hier
(einige Zeilen weiter) oben am 28.8.2025 auf
800 Pixel Breite verkleinert.
Und hat dank des Artikels von Bernhard R. Appel dieses Bild aber
endlich genau in
der
Ur-Abdruck-Quelle, LEIPZIGER ILLUSTRIRTE
ZEITUNG (neben dem Programmheft von 1852, aber das wurde ja in
Düsseldorf vermutlich vor Ort verkauft oder ausgeteilt) vorgefunden.
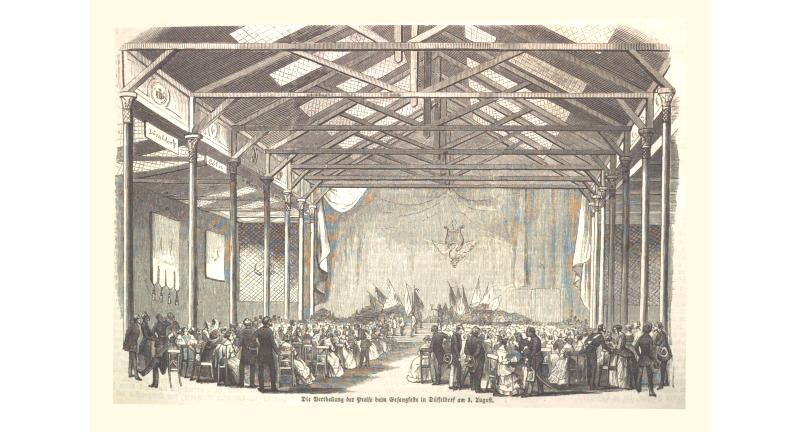
Hier sehen wir die Ur-Ansicht aus der
Illustrirten Zeitung, von K. J. auf 600 Pixel Bild verkleinert und
aufgehellt. Wir sehen: Das Bild von WIKIMEDIA COMMONS (weiter oben) und
das
BILD hier, es ist dasselbe Bild, aber in jeweils etwas anderer
Variante. (K. J. hat das untere Bild zudem aufgehellt!)
Wir
dürfen auch annehmen: Die LEIPZIGER ILLUSTIRTE
ZEITUNG
druckte die Zeichnung zur NEUEN HALLE 1852 erstmals für eine deutsche
Öffentlichkeit ab. (Und, immer wichtig, es gab auch noch das
Programmheft in
Düsseldorf
1852 vor Ort mit eben dieser Zeichnung.)
Diese Ilustrierte aus Leipzig sollte fortan an
immer als DIE
deutschlandweite
QUELLE
für die Zeichnung von HALLE ZWEI (NEUBAU) 1852 im Geisler-schen Garten
(= GEISLER-SCHE HALLE NEU) genannt werden. (Das Programmheft jener
Augusttage dürfte
hingegen nicht wie jene Illustrierte an deutschlandweite Abonennten
verschickt worden sein.)
Diese (vermutliche) Ur-Quelle für den allersten öffentlichen Abdruck der Zeichnung in einer
Zeitschrift (abgesehen vom Programmheft des Gesangsfestes 1852,
als Innentitel) zur GEISLER-HALLE
NEU von 1852 nämlich ist, ausführlich, so:
Seite 125
in der (Leipziger) "Illustrirten Zeitung" vom 21.8.1852, Nr. 477, XIX.
Band, NEUE FOLGE, VII. BAND – Der Artikel in der "Illustrirten
Zeitung" geht über 3 Seiten (125 bis 127) und Seite 125 hat sogar
insgesamt
zwei (!!!) Abbildungen. Beide Abbildungen des Artikels stehen auf
jener Seite 125.
In der Unterzeile der größeren Abbildung (siehe
erneut oben
das Bild, die Bilder) steht klein: "Die
Vertheilung der Preise beim Gesangsfeste in
Düsseldorf am 3. August."
Die Jahreszahl 1852 wurde bei Wikimedia Commons handschriftlich von
einer Person auf die Zeichnung hinzugefügt. Aber in der Urquelle
"Illustrirte Zeitung"
fehlt diese handschriftliche Zufügung natürlich. Durch den Zusammenhang
wird allerdings die Jahreszahl 1852 eindeutig. Das Gesangsfest, weshalb
man den Neubau errichtete, war im August 1852, 1.8.1852 bis 4.8.1852.
Leider findet man
keinen
Namen, wer da die NEUE GEISLER-SCHE HALLE 1852 gezeichnet haben könnte
oder wer den
Stahlstich
dazu verantwortete. In der ganzen Ausgabe der "Illustrirten Zeitung"
nicht.
Das Gesangsfest 1852 fand, so liest man, parallel
zur
Provinzial-Gewerbe-Ausstellung für Rheinland und Westphalen statt.
SIEHE
auch
commons.wikimedia.org/wiki/File:The_31st_Lower_Rhine_Music_Festival-1852.png
DAS BILD bei Wiki Commons IST
GEMEINFREI. ![]()
HINWEIS K. J.: In dem
Halbjahressammelband der Illustrirten Zeitung, 1852, 2. Halbjahr, Juli
bis Dezember, gibt es am Ende neben dem Inhaltsverzeichnis auch ein
Illustrationsverzeichnis. In diesem wird (ja!) ein Bild / eine
Illustration
zu der Düsseldorfer Sängerhalle erfasst. Es steht jedoch leider nicht
da, wer das große
Bildnis (auf Seite 125 unten) schuf, welcher
Künstler.
IN DEM BESAGTEN ARTIKEL Seite
125/126/127, auf
127 ist es dann nur noch die linke Spalte von vieren,
in der (Leipziger) "Illustrirten Zeitung" vom 21.8.1852, Nr. 477, "Das
Gesang- und Künstlerfest zu Düsseldorf am 1. bis 4. Aug. 1852." steht
u. a. folgendes:
"[...] Nach
vielen Berathungen faßte man endlich den Entschluß, in den schönen
Promenaden des genannten Locals einen eignen, hinlänglich geräumigen
Festsaal zu bauen. Dem gefassten Beschlusse folgte rasch die
Ausführung, da der Besitzer des Locals, Herr Geisler, mit der
anerkennungswürdigsten Bereitwilligkeit den Wünschen des Festcomités
entgegenkam. Und so erhob sich denn bald die prächtige Tonhalle, die
dem Feste einen in jeder Beziehung würdigen Anhalts und
Bereinigungspunkt bot. Dieselbe stand, wie schon bemerkt, inmitten der
schönsten Gartenanlagen, umfaßte drei große Schiffe und war 180 Fuß
lang, 76 Fuß breit und 40 Fuß hoch. [...]"
Der gesamte Artikel
trägt keinen Verfassernamen. Am Ende gibt es eine Kenn-Nummer für den
Artikel = 7012. – Anbei sieht man die besagte Seite 125 mit den zwei
Illustrationen stark verkleinert. K. J. hat dieses Mini-Abbild der
Seite am
29.8.2025 erschaffen und hier in die Homepage-Seite eingebaut. – Einen
"eignen" Festssaal zu bauen, das könnte meinen: Fürs Singen haben wir
schon einen Saal, aber fürs richtige Singen, für eine mehrtägige
Gesangsveranstaltung ... mit vielen Besuchern, haben wir noch keinen
Saal. (Das ist eine K.-J.-DENKTHESE, weshalb es zwei Säle auf einem
Grundstück
gewesen sein könnten ... und ja auch waren. Offenbar: ein BAU ALT aus
STEIN und ein ANBAU NEU
= 2 HALLEN aneinander. Und die NEUE HALLE aus HOLZ wird größer gewesen
sein. Mehr
Publikum
passte hinein.)
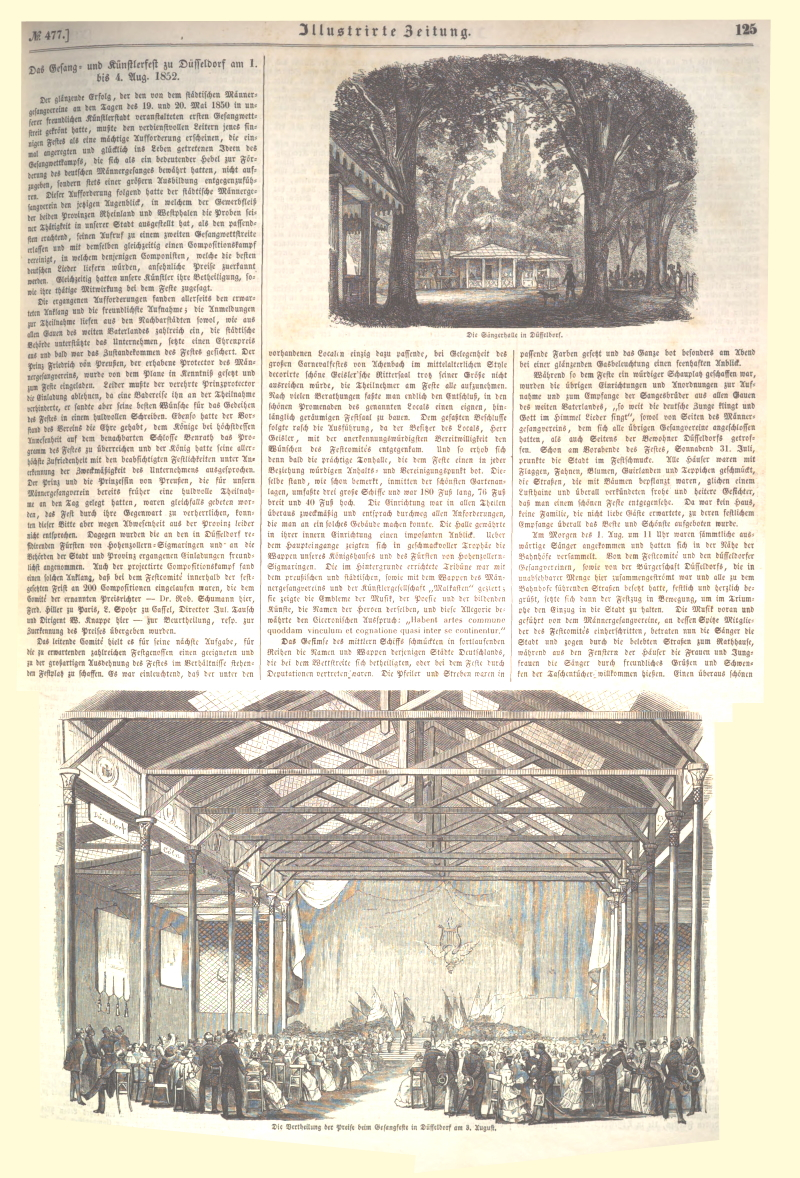
____________________________________
K. J. hat nun auch
die kleinere, zweite Abbildung, die obere kleinere Abbildung, aus der
"Illustrirten Zeitung"
als JPG-Bild erschlossen. Diese Abbildung ist ebenfalls auf jener Seite 125 (hier direkt oben auf
dieser Webpage ist die ganze Seite ja als Mini-Abbild zu sehen) in
der (Leipziger) "Illustrirten Zeitung" vom 21.8.1852, Nr. 477, XIX.
Band, NEUE FOLGE, VII. BAND. ... Zuerst der Kopf der
Ausgabe vom 21.8.1852:

:::
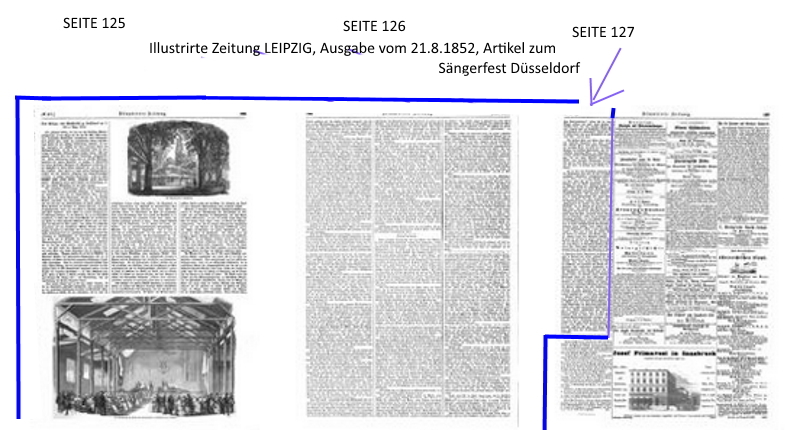
Hier
sind alle
drei Seiten des Artikels zum Sängerfest Düsseldorf 1852 in
KLEIN-Ansicht. 21.8.1852, LEIPZIGER Illustrirte Zeitung. K. J. hat
diese 3- Seiten-Ansicht am 30.8.2025 auf diese Web-Page hier gesetzt.
Und
jetzt folgt, nochmals weiter unten, das
fürs Internet nun hier auch noch erschlossene ... ganz neu
erschlossene, kleinere Bild,
eine Außenansicht der Musikhalle
im Geisler'schen Garten.
Hier aber sieht die HALLE sehr gedrückt aus, klein, gar nicht hoch und
weit.
Sollte das noch die ALTE HALLE EINS (die alte) im Geisler'schen Garten
gewesen
sein? Oder doch bereits die HALLE ZWEI NEU (die neue) ab 1852?
Beziehungsweise der
ADDITIONSBAU HALLE ALT plus HALLE NEU? – Die Dinge
scheinen noch nicht ganz bzw. zu 100 % klar. Man bräuchte
weitere Abbildungen zu der HALLE / den HALLEN: ALTE HALLE,
NEUE HALLE = KOMBIBAU, alles im Geislerschen Garten. – K. J. hat
jedenfalls das andere (noch nicht so bekannte kleinere) Hallen-Ab-Bild
am 28.8.2025
"ausgeschnitten" und auf 800 Pixel verkleinert. Quelle: Seite 125 in der (Leipziger)
"Illustrirten Zeitung" vom 21.8.1852, Nr. 477, XIX. Band, NEUE FOLGE,
VII. BAND – Der komplette Artikel zum Gesangsfest 1852 geht über 3
Seiten (125 bis 127) und hat insgesamt zwei
Abbildungen. – Dieses Bild hier unten ist natürlich ebenso
gemeinfrei. ![]() Außerdem ist auch der Zeitungskopf weiter oben
gemeinfrei.
Außerdem ist auch der Zeitungskopf weiter oben
gemeinfrei. ![]()

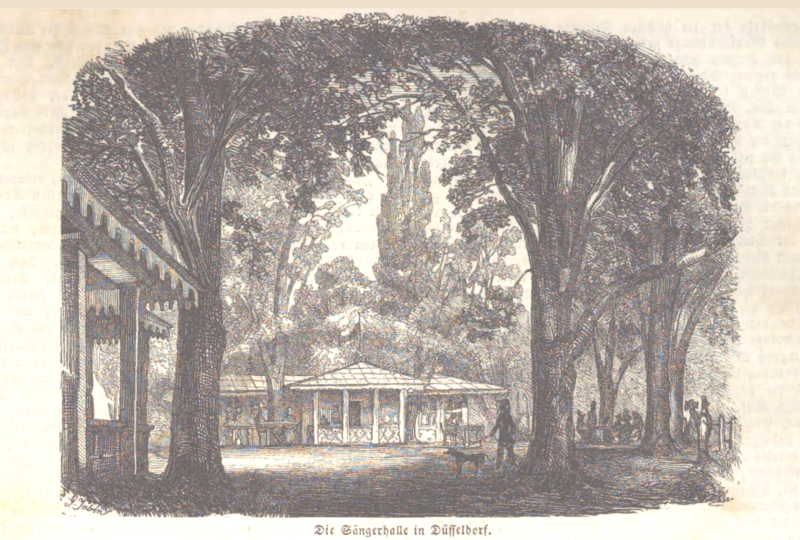

Wo also wäre noch eine doppelt und
dreifach gesicherte
Abbildung
von der GEISLER'SCHEN NEUEN HALLE = HALLE ZWEI zu finden, die erst 1852
gebaut bzw. erstellt wurde? (Außenansicht!) Extra neu erschaffen 1852
bereits schon für das Sängerfest des
Jahres 1852 ab 1. August.
Das fragt K. J. [[ Wie gerne würde man ALTE
HALLE EINS und NEUE HALLE = ZWEI nebeneinander auf einem Bildnis sehen!
Beide zusammen im Garten von Geislers Ausflugs-Lokal. ODER WAR ES
OPTISCH EINE
KOMBIHALLE ... die sofort zwei BAUTEN (einen alten, einen neuen) zu
EINEM
NEUEN BAU optisch vereinte? Oder müssen wir eher so denken: ANBAU plus
ANBAU, aber optisch dennoch deutlich als zwei
Gebäudeteile zu erkennen? ]]
ZITAT zum NEUBAU 1852: >>>Hofkonditor Geisler hat sich demnach
bereiterklärt, „das neue Lokal unmittelbar an den
jetzigen großen Saal anzubauen, so zwar, daß die rechte Wand in gerader
Linie an die des alten Saales anschließt, die linke
dagegen soviel, als der neue Saal breiter wird, in den Garten
vorspringt.<<< Düsseldorfer Journal am 30. April
1852. Das ZITAT fand sich bei Bernhard R.
Appel: Geislers Saal und die
Tonhalle. In: Neue Chorszene. Zeitschrift des Städtischen
Musikvereins zu Düsseldorf e. V. Konzertchor der Landeshauptstadt
Düsseldorf, 16. Jahrgang, Ausgabe 1 (Januar 2012), S. 38.
Die neue (TON)HALLE ab 1852, der NEUE GEISLER'SCHE SAAL des Jahres 1852
... war also zugleich ein ANBAU oder ZUSATZBAU an die breits
existierende
Halle. – Ja, es gab demnach dann zwei HALLEN nebeneinander, die beide
auch genutzt
wurden.
Man lese dazu auch dieses ZITAT: >>>Für die
Abonnementskonzerte, die Robert
Schumann von 1850 bis 1853 leitete, wurde jedoch nach dem Neubau der
Tonhalle weiterhin der kleinere Geislersche Saal genutzt, über dessen
Akustik sich die Hamburgerin Louise Japha, Bekannte von Johannes Brahms
und Klavierschülerin von Clara Schumann, in einem Brief an Julius
Schaeffer vom 20. November 1852 positiv äußert: „Der Concertsaal ist
sehr schön und größer als unser Hamburger
Apollosaal; es klingt darin gut, besonders wenn der Saal recht
gefüllt ist, was bisher bei jeder Aufführung der Fall war“.<<<
Das ZITAT fand sich ebenfalls bei Bernhard
R. Appel: Geislers Saal und die
Tonhalle. In: Neue Chorszene. Zeitschrift des Städtischen
Musikvereins zu Düsseldorf e. V. Konzertchor der Landeshauptstadt
Düsseldorf. 16. Jahrgang, Ausgabe 1 (Januar 2012), aber S. 40.
:::
Autor Bernhard R. Appel (Großen Dank für seine Recherchen!) nannte
jedoch endlich die
exakte Bild-Quelle ((wurde weiter oben schon angesprochen)) für
die (neue) Geisler'sche Halle des Jahres 1852: Denn
Fußnote 13 und 14 bei ihm, bei Appel, sagen Folgendes: "13 Eine Außenansicht der Sängerhalle
findet sich auf dem
Innentitel des Programmheftes Grosses Gesangfest. Gesangwettstreit,
Compositionskampf, Concert
und Grosses Künstlerfest der
Gesellschaft Malkasten am 1., 2. 3. und 4. August 1852. Programm und Festordnung
[...], Düsseldorf [1852].
Diese Darstellung findet sich auch in der Berichterstattung Das
Gesang= und Künstlerfest
zu Düsseldorf am 1. bis 4. August 1852 in der Jllustrirten Zeitung, Nr.
477, S. 125. UND
14 Beschreibung und Abbildung dieser
1847 gebauten Sängerhalle vgl. K. F. E. Langenhoff, C. Seebach, De
Muzen omsingeld. Musis sacrum 1847-1983, Arnhem 1983, S. 7ff. [[ach so: ARNHEIM
war ein
Vorbild für
die Architektur der (NEUEN) GEISLER'SCHEN HALLE ZWEI von 1852]]
– Appel
hat zur NEUEN HALLE ZWEI weiter herausgefunden: >>>Die Maße des mit dem Namen Tonhalle
belegten neuen Gebäudes veröffentlicht das Düsseldorfer Journal am 30.
April 1852: Hofkonditor Geisler hat sich demnach bereiterklärt, „das
neue Lokal unmittelbar an den jetzigen großen Saal anzubauen, so zwar,
daß die rechte Wand in gerader Linie an die des alten Saales
anschließt, die linke dagegen soviel, als der neue Saal breiter wird,
in den Garten vorspringt. Das Mittelschiff der neuen Sängerhalle wird
40 Fuß breit [ca. 12,5 m], die Seitenschiffe 20 Fuß breit [ca. 6,3 m]
und die Länge des Ganzen soll sich soweit ausdehnen, daß für etwa 5000
Personen Raum im Innern ist“.<<< 5000 Personen !!! Wow !!! Sagt K. J.




_____________________________________________________________________________
Düsseldorf.
___________________________________________________________
* Düsseldorf, 16. Mai. Nachdem gestern der Messias unter großem Beifall aufgeführt worden und mit der heutigen Aufführung das allgemeine Fest schloß, ist für Dienstag das Programm des Künstler-Concertes wie folgt, festgesetzt:
1) Hallelujah aus Messias von Händel. Diese Piece erregte schon gestern einen ungewöhnlich starken Applaus.
2) Arie „Gott sei mir gnädig“ aus Paulus von Mendelssohn, vorgetragen von Hrn. Salomon, der sich gestern durch seinen reinen Baß auszeichnete und Alle zur Bewunderung hinriß.
3) Romanze aus „Ein Traum in der Christnacht“ von Hiller, gesungen von Hrn. Koch.
4) Clavier-Concert von Schumann, gespielt von Frau Clara Schumann. Bei der bekannten Virtuosität der Künstlerin erwarten wir von diesem Stücke einen herrlichen Kunstgenuß.
5) 3 Lieder, schottisch und englisch, von Frau C. Novello gesungen.
6) Werden wir eine Ouvertüre von unserm jungen talentvollen Tausch hören.
7) Adelaide von Beethoven, welche Hr. v. d. Osten singt und Frau Schumann accompagnirt.
8) Violin-Concert von Beethoven, von Joachim gespielt.
9) Eine Arie, gesungen von Fr. Novello.
10) Eine freie Clavier-Fantasie von Hiller, der in diesem Genre bekanntlich Meister ist.
____________________________________________________________________________
Polizei-Verordnung.
Auf Grund des §. 5 des Gesetzes über die Polizei=Verwaltung vom 11. März 1850 wird für die Tage des 15. 16. und 17. Mai c., während des hierselbst stattfindenden 31. Niederrheinischen Musikfestes, zur Sicherung der freien Passage Folgendes verordnet:
1. Alle Gefähre, welche Personen nach dem Geisler'schen Garten=Lokale bringen, müssen von dem Flingerthore her anfahren und nach dem Jägerhofe hin, durch die Jacobistraße, abfahren.
2. Alle unbesetzte Gefähre, welche Personen vom Geisler'schen Lokale abholen wollen, müssen von dem Jägerhofe her durch die Jacobistraße anfahren und die Schadowstraße entlang abfahren.
3. Die Aufstellung von Gefähren am Geisler’schen Lokale und in der Nähe desselben, darf nur nach specieller Anordnung der dorthin beorderten Polizeibeamten erfolgen.
4. Um alle Straßenecken und im Gedränge muß im Schritt gefahren und geritten werden.
5. Wer gegen diese Verordnung fehlt, verwirkt eine Geldstrafe von 1—3 Thaler.
Düsseldorf, den 12. Mai 1853.
Der Königl. Polizei=Direktor.
Der Bürgermeister, A. A.
Hammers. Reinecke,

Der folgende ARTIKEL zum 31. Niederrheinischen MUSIKFEST 1853 erschien am 21.5.1853 und 28.5.1853 und 4.6.1853, also in 3 Ausgaben, als FORTSETZUNG: Römisch I. (21.5.1853) und II. (28.5.1853) und III. (4.6.1853) K. J. hat diesen Artikel (alle 3 Teile) samt 1. Zeitungskopf (21.5.1853) als JPG-Bild am 12.9.2025 als offenen Internet-Text in diese Web-Seite hier hineingestellt.
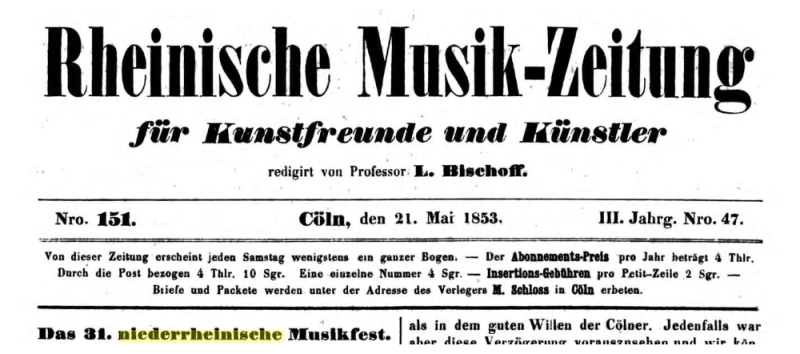
QUELLE: "Rheinische
Musik-Zeitung für
Kunstfreunde und Künstler"
-- redigirt von Professor L. Bischoff.
Nro. 151. Cöln, den 21. Mai 1853. III.
Jahrg. Nro. 47.
fortlaufende
Paginierung im Jahrgang: Seiten 1201,
1202, 1203
Von dieser
Zeitung erscheint jeden Samstag wenigstens ein ganzer Bogen. – Der
Abonnements-Preis pro Jahr beträgt 4 Thlr. Durch die Post bezogen 4
Thlr. 10 Sgr. Eine einzelne Nummer 4 Sgr. – Insertions-Gebühren
pro Petit-Zeile 2 Sgr. – Briefe und Packete werden unter der
Adresse des Verlegers M. Schloss in Cöln erbeten
Als nach einer dreijährigen Unterbrechung die Stadt
Aachen im
Jahre 1851 die Feier des niederrheinischen Musikfestes an den
Pfingsttagen wieder aufnahm, da freuten wir uns im Interesse der
Kunst und des Rheinlandes dieser Wiedergeburt eines Festes, das
wir fast ein Menschenalter hindurch als mit der Frühlingsfeier am
Rhein innig verbunden zu betrachten gewohnt waren. Der Erfolg bewies,
wie tief die Liebe zu diesem vaterländischen Kunstinstitut
wurzelte: die Theilnahme war über alle Erwartung zahlreich.
Dennoch ging das Jahr 1852 wiederum ohne Musikfest vorüber: – die
Stadt Cöln, an der die Reihe war, hatte nicht den – – ja, was
hatte sie denn eigentlich nicht ? die erforderlichen musikalischen
Kräfte, um den Stamm zu bilden P Ei! ein Chor von 250–300 Stimmen
und ein Orchester mit 24 Violinen u. s. w. dürften wohl dazu
hinreichen. Aber ein Lokal P Freilich – der GürzenichSaal
fasst nur 4000 Menschen, dass ist wahr – und es sind erst 9 Mal die
Musikfeste darin gehalten worden – wer weiss, wie es das
zehnte Mal geklungen hätte? Aber halt: der Umbau desselben war
beschlossen, er sollte im vorigen Frühjahr in Angriff genommen
werden. Er ist zwar auch heute nur noch Plan oder Idee, wie die
Menschen zu sagen pflegen – unstreitig aber nicht nur eine
schöne, sondern auch eine für Cöln durchaus nothwendige Idee: und
wenn der Mensch sein Leben für eine Idee opfern soll, warum nicht
auch ein Musikfest? So fiel das vorjährige Fest einem Projekte
zum Opfer, dessen schnelle Verwirklichung übrigens dem Vernehmen
nach anderswo Hindernisse fand, als in dem guten Willen der Cölner.
Jedenfalls war aber diese Verzögerung vorauszusehen und wir könmen
Cöln nicht völlig freisprechen: entweder kennt es seine Bedeutung
für die musikalischen Zustände in Deutschland noch nicht, oder, was
wahrscheinlicher ist, es ist noch nicht darüber im Klaren, was
zu thun ist, um eine solche Bedeutung zu bewahren und zu
erhöhen.
Düsseldorf,
in seinen musikalischen Kräften gar nicht mit
Cöln zu vergleichen, besonders bei der Erlahmung und Entmuthigung,
ja Zerrissenheit derselben in neuerer Zeit *), hat es dennoch
für eine Ehrensache gehalten, das Musikfest aufrecht zu erhalten,
hat das Unternehmen mit Muth in die Hand genommen und mit Glanz
durchgeführt. Das Comité verdient deshalb den vollen Dank aller
Musikfreunde sowohl für die zweckmässigen Anordnungen, als für das
Vertrauen, welches es auf den Namen „niederrheinisches
Musikfest“ gesetzt, und welches durch das Herbeiströmen einer
Menge von Künstlern und Kunstfreunden von nah und fern vollständig
gerechtfertigt worden ist. Von Orchesterdirigenten und
Componisten begrüssten wir unter den Zuhörern u. A. die Herren
Seghers und Gouvy aus Paris, Jüllien aus London, Schnyder von
Wartensee aus Frankfurt, Verhülst
aus Rotterdam, Winkelmeier
aus Heidelberg, C. Müller aus
Münster, E. Frank und C. Reinecke aus
Cöln, Schornstein I. und Weinbrenner aus Elberfeld, Schornstein II.
aus Barmen, Lenz aus Coblenz,
Kirchner aus der Schweiz, Al. Schmitt
d. Jüng.
*) S. unten den Bericht über die musikalischen Zustände in Düsseldorf, den wir einige Wochen vor dem Musikfest aus ehrenwerther und unparteiischer Feder erhalten haben.
aus Frankfurt u. s. w. Die
Aufführungen
und selbst die Proben waren zahlreich besucht, besonders an den zwei
letzten Tagen, und der Andrang von Fremden in der Stadt überhaupt so
gross, dass es vielen unmöglich war, an den Mittagstafeln der
Gasthäuser Platz zu finden.
Das Fest fand in der neu erbauten
Tonhalle im Geisler'schen Garten statt. Wenn dies Gebäude auch nicht
eben besonders günstige akustische Verhältnisse hat, so
gewährt es gegen den frühern Saal doch den grossen Vortheil eines
unbeschränkten Raumes, indem es bei bequemer Aufstellung einer
Tonbühne für 6–700 Personen noch 1780 numerirte Sitzplätze für
die Zuhörer fasst.
Die vereinigten musikalischen Kräfte bildeten
eine imposante Masse von 650 Mitwirkenden, wovon die Vocalpartie 490,
die Instrumentalpartie 160 zählte. An künstlerischer Tüchtigkeit
stand die letztere jedoch weit über der erstern. Damit wollen
wir nicht sagen, dass der Chor ungenügend gewesen wäre; im
Gegentheil, er war gut in seinen Bestandtheilen, allein dem Ganzen
fehlte es an Sicherheit, an Zuversicht, an Dreistigkeit, an
Schwung und Freudigkeit. Trotzdem machte das Material der
klangvollen Stimmen eine schöne Wirkung, welche jedoch durch
längeres Studium, und theilweise durch eine energischere
Leitung, zu höherm Grade hätte gesteigert werden können.
Düsseldorf selbst hatte dazu 163 Sänger und Sängerinnen gestellt,
die Fremde sich mit 487 betheiligt, wobei Cöln mit 74, Aachen mit
48, Barmen mit 45, Elberfeld mit 39, Mühlheim a. d. Ruhr mit 25,
Wesel mit 20, Bonn mit 11, u. s. w. Das Verhältniss der Stimmen war
121 Soprani, 77 Alti, 133 Tenori und 159 Bassi. Der Alt trat trotz
des Abstands der Zahl nicht vor dem Sopran zurück, indess würden
12–20 Knabenstimmen – und die wären doch wohl aus dem Gymnasium
u. s. w. zu haben gewesen – die Wirkung bedeutend erhöht haben.
Im
Orchester war Alles gut und Vieles ganz vortrefflich. Unter den
65 Violinisten, angeführt von dem Concertmeister Hartmann aus Cöln,
begegneten wir glänzenden Namen, wie vor allem Joachim aus
Hannover und Pixis aus Cöln;
dann Becker aus Düsseldorf, Gleichauf
aus Brüssel, von Wasielewski
und Mohr aus Bonn, Wenigmann I.
und II. aus Aachen u. s. w.; die zweiten Violinen führte Derckum
aus Cöln, die Bratschen (27) Musikdirektor Weber aus Cöln, dabei u.
A. die Hrn. Kochner aus
Düsseldorf, Meckum aus Cöln, Reimers II.
aus Bonn; an den Violoncelli (25) die Herren B. Breuer aus Cöln,
Bockmühl aus Düsseldorf, Reimers II. aus Bonn, Wenigmann IlI.
aus Aachen u. s. w.; an den Bässen (12) A. Breuer aus Cöln, Sachar
aus Frankfurt a. M. u. s. w. Die Blasinstrumente in Holz und Blech
durchweg gut, zum Theil, wie Oboe, Fagott, Trompete,
vortrefflich.
Dirigenten waren am ersten Tage Robert Schumann,
am zweiten Ferdinand Hiller,
am dritten trat auch Jul. Tausch
aus
Düsseldorf für eine Ouvertüre von seiner Composition und zwei
Sologesangstücke dazu. Wir müssen es im Interesse der
Musikfeste durchaus missbilligen, wenn man bei Uebertragung der
Direction Lokalverhältnisse und persönliche Rücksichten walten
lässt. Schumann – bei aller Achtung vor seinem genialen
Compositionstalent – ist kein Dirigent, was man in Düsseldorf
auch recht gut weiss: er mochte immerhin seine eigenen Compositionen
dirigiren, das war genug. Und Tausch,
den wir als strebsamen und
talentvollen Musiker achten, ist noch nicht bedeutend genug, um auf
den Ankündigungen als Leiter eines niederrheinischen
Musikfestes neben Hiller und Schumaun genannt zu werden. Der
wirkliche Festdirigent konnte nur Hiller sein, weil er allein alle
Erfordernisse in sich vereinigt, die den Dirigenten machen.
Dergleichen städtische Verhätschelungen müssen vor der Würde der
Kunst an Musikfesten verschwinden. Was sollten wir in Cöln anfangen,
wenn wir bei einem zukünftigen Musikfeste neben dem eigentlichen
Festleiter die sechs bis acht hier lebenden Vereins- und
Orchesterdirigenten alle mit Direktion bedenken und auf den
Zettel drucken lassen müssten??
Der erste Tag des Festes, Sonntag
den 15. Mai begann mit der Aufführung einer neuen Sinfonie von Rob.
Schumann.
In diesem Werke begrüssen wir mit Freuden eine
geniale
Tonschöpfung des berühmten Meisters; in ihr ist Alles vereint, was
einem musikalischen Kunstwerke das Gepräge der Ursprünglichkeit
und Schönheit giebt. Da staunen wir nicht vor der künstlichen
Bearbeitung von Motiven ohne melodischen Gesang, da werden unsere
Nerven nicht erschüttert von schroff einschneidenden Harmonien, da
wenden wir uns nicht ab vor einer zur Manier gewordenen
Sonderbarkeit der Tonschlüsse – nein, in dieser Sinfonie
treten gleich von vorn herein Tongestalten uns entgegen, welche nicht
der grübelnde Verstand geschaffen, sondern die dem
überquillenden Born des innersten musikalischen Lebens wie
Meerjungfrauen entsteigen, welche durch die Liebe
eine
Seele bekommen haben. Und sie ziehen uns immer mehr zu sich hin,
sie umschlingen sich zu herrlichen Gruppen, bei denen wir nicht
wissen, ob ihre schönen Formen oder ihre lieblichen Gesänge uns am
meisten fesseln, und immer umspült sie in mannichfaltigen, reizenden
Figuren die stets klare, selbst im Aufschäumen helle und
durchsichtige Woge der Töne. Die Sinfonie, deren Haupttonart D moll
ist, besteht aus Einleitung,
Allegro, Romanze, Scherzo und Finale
in
Einem Satz, wird ohne Unterbrechung durchgespielt, ist jedoch
keineswegs zu lang, da jeder Satz – vor allem aber die Romanze und
das Scherzo, welche von wunderbarer Schönheit sind – sowohl die
Aufmerksamkeit fesselt als Fantasie und Gemüth in Anspruch nimmt.
Der Erfolg war denn auch ein ganz ausserordentlicher und bestätigte
den oft von uns ausgesprochenen Satz, dass bei guter Aufführung das
wahrhaft Schöne in der Musik auch bei dem ersten Hören uns sogleich
ergreift und mit Macht in unser Gefühl dringt. Von allen
Instrumentalwerken, welche für das niederrheinische Musikfest
componirt oder zum ersten Male auf demselben aufgeführt worden
sind, gebührt diesem unbedingt die Palme. Möge Düsseldorf stolz
darauf sein, einen Tondichter wie Robert Schumann zu seinen
Mitbürgern zu zählen! Das Schaffen
ist dessen Beruf: und wer
von Einem, den der Genius dazu geweihet hat, verlangt, dass er
sich auch in allen praktischen Dingen wie andere Erdensöhne gebaren
solle, der verkennt eben die Natur des Genius. Aber Eins dürfen
wir nicht verschweigen, Eins müssen wir Schumann zmrufen: „Schaue
rückwärts! Werde wieder, was Du warst, stosse die holden
Melodien nicht absichtlich von Dir, wenn sie Dich suchen wie vormals,
vergrabe Dich nicht in das struppige Dickicht, wo die Ungethüme und
absonderlichen Gebilde hausen, durchziehe wie sonst den hohen
lichten Eichenwald, in den der blaue Himmel hereinblickt und auf
dessen grünen Matten die Sonnenstrahlen wärmen und treiben!“ Und
wie kominen wir zu diesem Zuruf P Weil diese Sinfonie, die uns
entzückt hat, nicht jetzt, sondern vor
acht bis zehn Jahren
geschrieben ist und von Schumann selbst vielleicht zum Begrabensein
bestimmt war! Jetzt wird sie hoffentlich so bald wie möglich
gedruckt; dann wird sie im nächsten Winter durch ganz
Deutschland wandern und ganz Deutschland wird in unsern Ruf
einstimmen.
Fortsetzung
vom Artikel zum 31. Niederrheinischen Musikfest 1853 erschien in der
nächsten Ausgabe der
Rheinischen Musik-Zeitung
Die Ausgabe vom 28. Mai 1853
fortlaufende
Paginierung im Jahrgang: Seiten
1209, 1210, 1211, 1212
QUELLE: Nro. 152. Cöln, den 28. Mai 1853. III. Jahrg. Nro. 48.
Nach der Sinfonie von R.
Schumann folgte die Aufführung von Händels
Messias.
Hier drängt
sich von vorn herein die Frage auf: „Wie weit soll man bei der
Aufführung von Händel'schen Oratorien im Concertsaal – nicht
in der Kirche – die Pietät in Bezug auf die Ganzheit des
Werks treiben?“ – Wir antworten ohne im geringsten zu
zögern, dass wir - nicht zu denjenigen gehören, welche die
Unantastbarkeit desselben predigen: wir halten es im Gegentheil für
wahre Pietät, seine Längen zu verkürzen, seine Schwächen dem
Blick zu entziehen, um das grosse und erhabene Schöne desselben
nicht bloss in den bestäubten Partituren für Wenige, für Musiker
und Kenner, sondern für das allgemeine Kunstleben, für die Anregung
der ganzen Masse der gebildeten Kunstfreunde zu erhalten und von
Zeit zu Zeit wieder lebendig zu machen. Der Zorn der eingefleischten
Klassiker, oder richtiger gesagt Alterthümler, über Auslassungen
und Verkürzungen wäre nur dann berechtigt, wenn von einem
historischen Concerte die Rede
wäre, das uns z. B. den Messias
gerade wieder so vorführte, wie Händel ihn erst seinem Könige in
der leeren Kirche, und nachher den grossen zahlreichen Gemeinden von
Dublin und London vorgeführt hat. Da dies aber gar nicht mehr
möglich ist, da wir im Messias gar nicht mehr den reinen Händel,
sondern Händel und Mozart hören, so begreife ich nicht, wie die
Pietät, welche auf der einen Seite ruhig zusieht, dass der
ursprüngliche Leih in einer neuen Draperie als ein ganz anderer
erscheint, sich wie rasend gebärden dürfe, wenn man einen Schritt
weiter geht und der einmal doch schon modernisirten Gestalt auch noch
den Zopf abschneidet. Wir wünschen und verlangen, dass Händel den
grossen Concerten und namentlich den Musikfesten in Deutschland
erhalten werde, aber eben deswegen ist es an der Zeit, seine Werke
nach richtigen Grundsätzen zu verkürzen und zusammenzuziehen:
– dies ist jetzt eben so nöthig, um ihn uns zu erhalten, als vor
30 bis 50 Jahren eine ergänzende Instrumentirung bereits ein
Bedürfniss geworden war.
Dazu kommt, dass jedem Unbefangenen
bei Durchsicht der Händel'schen Werke die Ueberzeugung nicht
fern bleiben kann, dass bei ihm die ästhetische Kunstform des
Oratoriums als eines Ganzen keineswegs vollkommen ist, dass von
der gepriesenen Einheit der Handlung oder der Idee, die durch
Auslassungen zerrissen werde, u. dgl. m. eigentlich nicht die
Rede sein kann. Mit Ausnahme des Samson lässt sich in allen
seinen Oratorien ein Mangel an Einheit und Steigerung
nachweisen, und eine Menge von Nummern, welche wir als
nothwendige Bestandtheile des Kunstwerks hinnehmen sollen, verdanken
ihre Entstehung und Einordnung nichts anderm, als dem zur Zeit
geltenden musikalischen Zuschnitt und den Concessionen an den
damaligen Geschmack. Auch ist es bekannt genug, dass Händel Arien
aus seinen Opern in die Oratorien aufnahm und in den Oratorien selbst
Chöre aus einem in das andere versetzte, wie z. B. den prächtigen
Siegsgesang in G dur aus dem Maccabäus in den Josua.
Bei
Messias ist nun noch etwas Anderes in Betracht zu ziehen. Händel
fasste seinen Vorwurf ganz anders auf, als einige Jahre später
Klopstock. Wenn dieser das ganze Leben und die Wirksamkeit des
Messias in epischer Folge darstellen und entwickeln
wollte und dabei an der Natur des Stoffs scheiterte, so fertigte
Händel die Zumuthung eines Englischen Bischofs zu etwas Aehnlichem
sehr energisch ab und fühlte ganz richtig, dass sowohl eine
epische Schilderung der Begebenheiten als eine dramatische
Darstellung derselben die Grösse des Gegenstandes niemals
erreichen würden. Er verwarf deshalb Beides und beschloss, nicht die
That, sondern die Idee der Erlösung durch die Kunst zu
verherrlichen. So musste denn das lyrische
Element vorwalten und
Händels Messias ist weit mehr eine grossartige Cantate, als ein
Oratorium – das Werk spricht die beseligenden und wehmüthigen
Gefühle der christlichen Menschheit über Geburt und Opfertod
des Heilandes, Ausbreitung des Evangeliums, Erlösung und ewiges
Leben aus, und will den Trost des Glaubens in die Herzen tragen auf
den Schwingen derjenigen Kunst, welche vor allen andern im
Stande ist, die Sehnsucht des menschlichen Gemüths nach Vereinigung
mit Gott auszusprechen.
Dadurch unterscheidet sich der Messias ganz
bedeutend von andern Händel'schen Oratorien. Samson, Judas
Maccabäus, Josua, Israel in Aegypten sind grossartige dramatische
Kunstgebilde. In ihnen ist eine Fülle von Handlung, im Messias
nichts als ein unendlicher Reichthum von Empfindungen und Gefühlen,
der Andacht, Hoffnung, des Schmerzes, des Trostes in der Liebe
Gottes, des Triumphes über das Reich des Herrn, der Zuversicht auf
ein ewiges Leben. Der Messias ist deshalb rein kirchlich und – es
muss einmal gesagt werden – er passt von allen Händel'schen Werken
am wenigsten für den Concertsaal, womit wir jedoch keineswegs ihn
von grossen Concertaufführungen ganz und gar verbannen wollen,
eben so wenig als Bach'sche Cantaten und Cherubini'sche und
Beethoven'sche Messen. Wir wollen mit diesem Ausspruch nur unserm
Ziele näher rücken.
In diesem Charakter des Messias nämlich liegt
nun eben der Grund, weshalb bei aller Vortrefflichkeit der
Composition dennoch eine gewisse Eintönigkeit vorhanden ist,
deren auf die Dauer ermüdende Wirkung schwerlich zu leugnen
sein dürfte. Das menschliche Gemüth hält eine zu lange andauernde
Spannung seiner höchsten Gefühle, namentlich in der Aufregung
durch Musik, nicht aus. Der Messias ist wie ein Dom von tönendem
Erz: die Stürme eines abgeschiedenen Jahrhunderts sind an ihm
spurlos vorübergegangen und er wird unter den Stürmen der kommenden
nicht verwittern. Gewiss, die Hallen eines gothischen Domes – wir
wollen im Bilde bleiben, das uns ja doch ohnedies so nahe liegt –
ergreifen uns mächtig und wunderbar: aber verweilen wir taglang in
ihren noch so herrlichen Gewölben, so sehnt sich die Seele doch nach
der freien Natur, nach dem blauen Himmel und dem Licht der Sonne,
nach dem Waldesgrün und dem lebendigen Hauche, der durch die
bewegten Wipfel weht.
Sind diese Betrachtungen richtig – und ihre
Wahrheit wird sich nicht wohl in Abrede stellen lassen – so
folgt daraus die Nothwendigkeit der Verkürzung des Messias für
den Concertsaal und zugleich der Grundsatz, welcher uns bei dieser
Verkürzung leiten muss. Es ist dieser: der Hauptcharakter des Werks
darf nicht verwischt werden, er muss im Gegentheil durch die
Zusammenziehung noch deutlicher ins Licht treten. Der Willkür
oder den Rücksichten auf Sologesang oder selbst auf den Werth
einzelner Nummern als Musikstücke an und für sich, darf dabei nicht
gefröhnt werden. Der Hauptcharakter des Messias ist aber
lyrisch: folglich muss das lyrische Element vor allem sein Recht
behalten, wogegen man diejenigen Nummern, welche in das Symbolische
und Mystische oder in das Dramatische streifen, aufopfern kann.
Man wird dadurch der Einheit des Kunstwerks nicht nur nicht schaden,
sondern sie fördern.
Hienach sind wir in Bezug auf die
Düsseldorfer Aufführung damit einverstanden, dass im ersten Theil
die Arie Nro. 3 „Alle Thale macht hoch“ wegblieb. Dagegen möchten
wir Nro. 5, 6 und 7 nicht entbehren: denn der erste Theil des
Messias zeigt uns den trostlosen Zustand der Welt und das Bewusstsein
desselben in den Herzen der Menschen: selbst die Verheissung, die in
Nro. 5 bestimmt ausgesprochen wird, weckt eine bange Ahnung: denn
„Wer vermag den Tag seines Kommens zu erleiden und wer
besteht?“ (Nr. 6). Aber die Hoffnung steigt in dem Chor Nro. 7 „Er
wird sie reinigen, die Söhne Levi“. Nun tritt mit dem
Recitativ des Alts Nro. 8 erst die eigentliche Verkündigung ein.
Hier müssen wir die Verkehrtheit rügen, in welcher man diesem
Recitativ in neuerer Zeit aus übel angebrachter Ziererei den
Text unterlegt: „Denn siehe, der Verheissne des Herrn ist
erschienen, dess Name heisst u. s. w.“ Der Englische
Originaltext
heisst Behold a virgin shall
conceive and bear a son, and shall call
his name etc. Wer also anstatt der Verkündigung der Geburt die
vollendete Thatsache derselben vorwegnimmt, auf welche Händel
durch die ganze Hälfte des 1. Theils vorbereitet,
um sie erst
in Nro. 13 „Es ist uns ein Kind geboren“ mit aller Kraft zu
verherrlichen, der hat keine Idee von dem Bau des Ganzen, der
vernichtet die so schön berechnete Steigerung der Gefühle bis zu
dem Hauptmoment der Geburt und verwirrt das Verständniss des
ganzen ersten Theils. Will man den biblischen Text nicht geradezu
wörtlich beibehalten, so lasse man singen: „Und siehe, eine
Jungfrau ist erkoren zu gebären einen Sohn, dess Name heisst
Immanuel“. – Darauf verkündet eine Stimme mit der schönen
Melodie gläubiger Zuversicht „Wonne in Zion“ (Nro. 9) und nun
falle die Verherrlichung der wirklichen Geburt des Heilandes mit Nro.
13 ein: „Es ist uns ein Kind geboren.“ Aber warum liess der Herr
Dirigent hier die nacheinander eintretenden Soli der vier
Stimmen vom ganzen Chor singen? Diese Aenderung behagt uns gar
nicht: erst sprechen sich einzelne Stimmen freudig aus, wie froh
bewegte Zeugen, und dann bricht das Erstaunen einer ganzen Welt:
„Wunderbar! Herrlichkeit!“ mit aller Glorie hervor. So hat
es sich Händel gedacht und diese grossartige Wirkung soll man ihm
nicht verkümmern.
Man sieht, dass wir Nro. 11 und 12 auslassen. Ihr
Inhalt ist mystisch und geht zum Theil auf den trostlosen Zustand der
Menschheit wieder zurück, der durch die Hoffnungen in Nro. 7, 8, 9
schon überwunden ist. Auch hätten wir gar nichts dagegen, wenn
der erste Theil mit dem Chor Nro. 13 schlösse – ja, er wäre für
sich allein schon eine herrliche Weihnachtscantate.
Jedenfalls müssen
wir das Instrumental-Pastorale Nro. 14 streichen, welches gar keine
Berechtigung hat, da die Hirten nachher eben nur mit einem Wort
erwähnt werden, aber keineswegs die Bedeutung haben, dass sie auf
die Einführung durch 32 Takte Instrumentalmusik Anspruch machen
könnten. Wir lassen aber auch Nro. 15, die Erzählung von der
Erscheinung des Engels und Nro. 16, den Chor der Engel, weg; was soll
das Stückchen epischen Elements unter den lyrischen Ergüssen ?
Wozu die Engel ein einziges Mal herbeiziehen, wo das ganze Oratorium
nur die Empfindungen der Menschen ausspricht? Und kann dieser Chor
„Ehre sei Gott in der Höhe“ – nicht bloss desshalb, weil uns
so manches treffliche und begeisternde Gloria in Ercelsis Deo seitdem
geschrieben worden ist, sondern abgesehen davon – nach der
Nro. 13 noch eine gesteigerte Wirkung hervorbringen? Unmöglich. Die
Arie in B dur, Nro. 17
„Erwache zu Liedern der Wonne“ lassen wir
auch fallen: ihr Inhalt kömmt wie man zu sagen pflegt post festum,
denn der Jubel ist schon dagewesen. Sie ist nichts als eine
Concession an den Solotenor, der aber mit ihr in unserer Zeit auch
keine Lorbeern ärnten wird.
Wir schliessen also unmittelbar an Nro.
13 (G dur) das Recitativ Nr.
18 (G dur) „Nun thut das Auge
des
Blinden sich auf“, worauf denn die Sopran-Arie Nro. 19 „Er weidet
seine Heerde“ und der Schlusschor Nro. 20: „Sein Joch ist
sanft“ folgen, durch welche drei Nummern eine Andeutung der
heilbringenden und alltröstenden Lehre des Heilandes gegeben
wird. Unser erster Theil enthält demnach statt der 20 Nummern der
Partitur dreizehn (in Düsseldorf 18).
Mit den Auslassungen im II.
Theil, wie sie in Düsseldorf stattfanden (Nro. 26, 27, 33, 34, 35)
sind wir bis zu Nro. 38 einschliesslich ganz einverstanden. Doch
könnte noch die Fuge Nro. 24 wegbleiben. Von da an lassen wir
aber auch noch Nro. 39 Arie „Warum entbrennen die Heiden?“, Nro.
40 Chor: „Auf zerreisset ihre Bande“ – Nro. 41 und 42
Tenor-Recitativ und Arie: „Du zerschlägst sie“ – ausfallen.
Unsere Gründe sind folgende. Der Inhalt des II. Theils zerfällt in
zwei Hälften: die erste
schildert die Gefühle beim Opfertod des
Heilands für die sündige Menschheit, deren „ganze Missethat
der Ewige auf ihn warf“ und den Jubel bei der Auferstehung; die
zweite das Ausgehen des
Evangeliums, der frohen Botschaft, in alle
Völker und den Triumph über den Sieg des Christenthums durch die
Macht Gottes, der „von nun an auf ewig regiert“. Die erste
schliesst mit dem prachtvollen Chor Nro. 32 in F dur: „Hoch thut
euch auf, ihr Thore der Welt!“, nach welchem deshalb bei der
Aufführung ein grösserer Ruhepunkt gemacht werden muss. Wir
knüpfen hier die Bemerkung an, dass die Dirigenten eins der
wirksamsten Mittel zum Verständniss eines grossen Musikwerkes und
zum Erfolg desselben bei den Zuhörern häufig entweder nicht kennen
oder vernachlässigen – nämlich die richtige Verbindung oder
Sonderung der einzelnen
Nummern, jene durch unmittelbares
Anschließsen, diese durch markirte Abschnitte. Wer jede Nummer
für sich absingen lässt, nach jeder eine gehörige Pause für
Niedersetzen, Räuspern, Schnupfen und andere sehr prosaische
Menschlichkeiten macht, der vernichtet wahrlich die Einheit eines
Kunstwerks weit mehr, als wer einige Gesangstücke überschlägt, und
er reisst den Zuhörer nur zu häufig ganz aus der Begeisterung
heraus. Ebenso fehlerhaft ist es aber auch, die nothwendigen
Abschnitte in der Handlung oder in dem Wechsel der Empfindungen
u. s. w. unbeachtet
zu lassen. Was den Chor Nro. 32 selbst betrifft, so ist ein Irrthum
von F. Rochlitz über ihn zu berichtigen: er findet darin eine
Hinneigung zum Dramatischen, wozu ihn der fragende und antwortende
Wechselgesang: „Wer ist der König der Ehren P – Der Herr u. s.
w..“ verleitet hat. Dieser Chor ist im Gegentheil ein Erguss der
höchsten Lyrik, ein antistrophischer Hymnus zur Verherrlichung
der Macht Gottes in der Auferstehung Christi. In seiner Wirkung wird
er nur vom Halleluja
übertroffen.
Dagegen greifen in der
zweiten Hälfte (Verbreitung des Evangeliums) die oben
angeführten Nummern 39–42 allerdings in's Dramatische über
und eröffnen eine Scene, welche nicht zu der Einheit des Ganzen
passt. Sie gehören übrigens – namentlich der Chor in C dur und
die Tenorarie in A moll, in
welcher das begleitende Motiv der
Sechszehntelfigur der Violinen durchaus nicht zu dem Charakter
des Stücks passt – zu den schwächsten Partien des Werkes.
Zwischen den Chor Nro. 38 in Es
und dem Halleluja in D lege
man das
kleine Recitativ Nro. 33 mit andern, passenden Worten, oder das
Recitativ Nro. 48 (in A dur
transponirt): „So ward erfüllt das
Wort des Wahrhaftigen: Der Tod ist in den Sieg verschlungen“ –
und schliesse dann mit dem Chor aller Chöre, dem Halleluja, welches
– wenn je ein Menschenwerk – ein Ausfluss göttlicher
Begeisterung ist. Sagte doch der alte blinde Händel selbst mit
Paulus' Worten von seinem SeelenzustaOriginaler SPERRDRUCK wurde hier
kursiv gesetzt. Dann lassen sich besser Worte suchen.nde, als er jenen
Chor
geschrieben: „Ob ich im Leibe gewesen bin oder ausser dem Leibe,
weiss ich nicht.“ – Der zweite Theil des Oratoriums,
ursprünglich 23 Nummern, enthielte dann nur 14 (in Düsseldorf 17).
Eine Aufführung, welche die vorgeschlagene
Anordnung befolgte
und mit dem Halleluja ganz und gar schlösse, würde in Rücksicht
auf Text und Musik ein einheitliches Ganze bilden, das sicher
seinen mächtigen Eindruck nicht verfehlte.
Händel wollte aber
ausser den Gefühlen, welche Verheissung, Geburt, Tod und
Auferstehung des Messias in der Brust erregen, auch noch die Erlösung
der Menschheit und die Zuversicht auf ein ewiges Leben in seinen Plan
aufnehmen und die Empfindungen des Christen bei den Gedanken
daran in Tönen aussprechen. In so herrlicher Weise er dies auch
– namentlich in der ersten Arie – gethan, so hält sich doch die
Spannung des Gemüths nach dem Vorhergegangenen, besonders nach dem
wunderbar Ergreifendem der Chöre „Hoch thut euch auf“ und
„Halleluja“, nur mit Mühe auf der bereits erreichten Höhe.
Mit der Abkürzung durch Weglassung der Nummern 48–51, wie sie auch
in Düsseldorf statt fand, sind wir deshalb ganz einverstanden.
Der
Bericht ist uns unter der Hand zu einem Artikel über die
Einrichtung des Messias zu
Concertaufführungen angewachsen, und
wir haben einige bereits früher an anderer Stelle ausgesprochene
Ansichten darin verwebt. Wir sehen allerdings ihre Verketzerung
von Seiten der musikalischen Orthodoxen voraus, fürchten uns
aber keineswegs davor und glauben im Allgemeinen im Interesse
aller derjenigen Kunstfreunde, denen es am Herzen liegt, dass Händel
so oft wie möglich wie das dröhnende Metall einer mahnenden
Riesenglocke an das verwöhnte Ohr der musikalischen Welt schlage,
geschrieben zu haben, und im Besondern im Interesse aller
Concertvorstände und Dirigenten, welche der Furcht vor der
Langenweile des heutigen Publikums das grösste und erhabenste
musikalische Kunstwerk, das der deutsche Genius erzeugt hat, zu oft
aufopfern.
Fortsetzung
(und Ende) Artikel zu Niederrheinisches Musikfest erschein in der
nächsten Ausgabe der
Rheinischen Musik-Zeitung.
Jetzt ist es die Ausgabe vom 4. Juni 1853.
Es
folgt
darin TEIL III.
fortlaufende
Paginierung im Jahrgang: SEITEN
1217, 1218, 1219, 1220, 1221
QUELLE: Nro.
153. Cöln, den 4. Juni 1853. III. Jahrg. Nro. 49.
Die Ausführung des Messias
war, trotz mancher allerdings auffallenden Mängel, im Ganzen
genommen dennoch eine befriedigende und grösstentheils
erhebende. Einige Chöre gingen vortrefflich, z. B. Nro. 4. „Denn
die Herrlichkeit Gottes,“ Nro. 16. „Ehre sei Gott“, Nr. 25.
„Der Heerde gleich“ – unstreitig die gelungenste Leistung,
obschon das Tempo wohl etwas langsamer hätte sein können – Nr.
32. „Hoch thut euch auf“ und der Schlusschor. Dagegen machten die
zwei gewaltigen: „Est ist uns ein Kind geboren“ und das
„Halleluja“ nicht den grossen Eindruck, den wir sonst an
Musikfesten bei solchen Nummern zu empfangen gewohnt sind. Es fehlte
nicht an trefflicher Besetzung von allen vier Stimmen, auch nicht an
dem Vertrauen der Einzelnen, aber wohl am Vertrauen des Ganzen,
der Masse, entweder auf sich selbst als Ganzes oder auf den Führer,
und so konnte sich die rechte Begeisterung nicht entwickeln, ja es
kam uns manchmal vor, als wenn der Chor sich ordentlich vor der
Begeisterung fürchtete, als wenn ihm die Zuversicht zu fehlen
schien, dass seine Lebendigkeit, sein Feuer und seine Freiheit durch
die leitende Macht doch stets vor dem Ausbrechen aus der gesetzlichen
Bahn des Rhythmus und Zeitmaasses würde bewahrt werden. Anders
können wir uns wenigstens ein zuweilen ganz merkwürdiges Erlahmen
mitten im Gesang und nach einem gelungenen Aufschwung kaum erklären.
Der Messias wurde in diesem Jahre zum vierten Male auf den
niederrheinischen Musikfesten aufgeführt, 1819 in Elberfeld
(Dirigent Schornstein), 1839
in Düsseldorf (Mendelssohn),
1847 in
Cöln (Dorn), nicht
eingerechnet 15 Nummern desselben, welche, ohne
leitenden Grundsatz nach Willkür zusammengestellt oder vielmehr
herausgerissen, am zweiten Tage 1826 zu Düsseldorf (Dir. F. Ries)
gegeben wurden. Von diesen Aufführungen war die diesjährige die
schwächste.
Die Soli waren in den Händen der Damen Clara Novello,
Mathilde Hartmann (Soprane), Sophie Schloss (Alt), der Herren
von der Osten (Tenor) und Salomon (Bass) aus Berlin. Unter
ihnen
glänzte Frau Clara Novello
als Stern erster Grösse. Sie war
uns in der Partie des Messias nicht neu; in Allen, welche dem
Musikfestc von 1839 in Düsseldorf beigewohnt hatten, lebte die
Erinnerung an sie und unsere Erwartung war deshalb umso
gespannter. Sie wurde nicht getäuscht, sie wurde in der That
übertroffen. Clara Novello, damals in der ersten Jugendfrische, hat
als Sängerin nicht nur nicht verloren, sondern an Wärme und
Seele des Vortrags bedeutend gewonnen und ihre Stimme hat dieselbe
wundervolle Gleichheit in allen Registern und dieselbe Fülle des
Klangs behalten. Es ist wahr, dass die Aussprache des Deutschen,
jedoch nur in dem Recitativ Nr. 15 hie und da etwas störend
war; aber die Arien Nr. 19 „Er weidctseine Heerde“ und Nr.
44 „Ich weiss, dass mein Erlöser lebt“ wurden hinreissend schön
von ihr gesungen. Ich kann im Wesentlichen nur wiederholen,
was ich schon 1839 schrieb, dass ich mich nicht so fest in den
kritischen Armstuhl eingeklemmt habe, dass ich bei solchem Gesang
noch etwas anderes als Ohr und Gefühl sein könnte. Da sagten mir
mancherlei Tonkünstler und Tonmäkler von theatralischen
Verzierungen, von allerlei Trillern, von Vortrag mit halber
Stimme und dergleichen, was zum Händel
nicht passe. Ich musste an den Kenner in Göthes Gedichten denken:
„Gut, brav! allein hier scheint es mir zu lang und hier zu breit,
hier zuckt's ein wenig“ – und dankte Gott, dass ich kein Kenner
sei! Ich will zugeben, dass die Fermate am Schluss der B-dur-Arie Nr.
19 hätte wegbleiben können: allein, wer die drei bis vier
zugesetzten Töne so singen kann, wie Clara Novello, dem verzeihe ich
sie gern. Und die Triller? Eine Sängerin, welche einen wirklichen
und schönen Triller machen kann,
hat das vollkommenste Recht, den
Vortrag dadurch zu verzieren, und das ist so wenig gegen den
Charakter der Händel'schen Arien, dass es im Gegentheil ein Mangel
an Vollendung des Vortrags ist, wenn eine Künstlerin, weil sie
derselben nicht mächtig ist, die Triller weglässt. In der ersten
Violinstimme der E-dur-Arie:
„lch weiss, dass mein Erlöser lebt“
– und die Violinen haben bekanntlich in dieser Arie häufig
dieselben Motive, wie der Gesang, in Vor-, Nach- und
Zwischenspielen – sind nicht weniger als 26 Triller vorgeschrieben,
und in der Singstimme selbst acht. Von diesen machte Clara Novello
nur zwei! Ehe ihr also vom Hörensagen und Nachsprechen über moderne
Trillerei in Händel den Stab brecht, thätet ihr besser, euch in
seinen Partituren umzusehen und dann zu urtheilen. Und „mit
halber Stimme?“ Nun, ich möchte das Piano, welches bei der Stelle:
„Ein Erstling derer, die schlafen“ wie ein zarter Morgenduft über
die Gräber derer, die unter dem Rasen ruhen, dahinschwebte, um
Vieles in der Welt nicht missen, zumal da auch der leiseste Ton noch
mit wunderbarer Schwingung erklang.
^ Neben der Novello hatte Frl.
Mathilde Hartmann aus
Düsseldorf einen schweren Stand; um so
mehr freut es uns, der bescheidenen Künstlerin sagen zu können,
dass sie die ihr zugefallenen Nummern, die Recitative und
Arioso's Nr. 28–31, welche zu dem Herrlichsten gehören, was
Händel für Sologesang geschrieben hat („Die Schmach bricht ihm
das Herz u. s. w.“), mit sehr klangvoller Stimme, durchaus
reiner Intonation und recht schönem Vortrag gesungen hat. – Fräul.
Sophie Schloss, welche sich am
Vorabend des Musikfestes – ein
schönerer Zeitpunkt war sicher für die berühmte rheinische
Sängerin nicht zu wählen – mit einem Kaufmann aus Hamburg verlobt
hatte, würde in dieser Stimmung eine Arie von Mozart oder Weber
schöner als je gesungen haben; in den beiden Händel'schen
blieb sie dem einfach grossen Vortrage treu, welcher ihre Leistungen
in Oratorien stets ausr gezeichnet hat. Auch sie sang im J.1839
dieselbe Partie, neben Clara Novello, und wenn wir damals von von ihr
sagten: „sie wird bald mit um den Preis ringen“, so hat sie
unsere Prophezeiung seitdem zur glänzenden Wahrheit gemacht. Der
Kunst kann eine Künstlerin wie Sophie Schloss nie untreu werden;
möge sie aber auch dem öffentlichen Auftreten sich nicht ganz
entziehen und noch manche musikalische Aufführung durch ihr
schönes Talent verherrlichen !
Ueber Herrn von
der Osten ist in
diesen Blättern schon oft gesprochen und wir sind, nachdem wir
ihn nun selbst gehört, mit dem Urtheile unseres Herrn
Correspondenten in Berlin ganz einverstanden, nur dürfte zum
Vortheil des Sängers zu bemerken sein, dass er an Tonbildung, reiner
Intonation und Deutlichkeit der Aussprache seit seinem ersten
öffentlichen Auftreten zu Berlin im Anfang des Jahres 1851 gewonnen
zu haben scheint. Herr von der Osten ist immerhin cin
beachtenswerthes Talent, welchem aber seine Sphäre so genau
angewiesen ist, dass er ohne Gefahr für sich selbst ihre engen
Schranken nicht überschreiten darf. Diese Sphäre bildet das
lyrische Element, nur in diesem kann er sich mit Erfolg bewegen;
dem oratorischen und dramatischen Gesang ist er nicht gewachsen.
Seine Stimme gehört zu jenen Tenören, deren Höhe leicht anspricht,
die aber in ihrem ganzen Wesen etwas so Zartes haben, dass man es
fast, krankhaft nennen möchte; es verlässt einen bei ihrem
Klang ein gewisses Gefühl nicht, was demjenigen gleicht, welches man
in der Unterhaltung mit liebenswürdigen aber sehr reizharen
oder nervenschwachen Frauen empfindet. Dass dies eine liebliche
Tonfarbe, die eben dadurch wieder ihren besondern Reiz hat,
nicht ausschliesst, versteht sich von selbst. Für
Oratorienpartieen, namentlich für Händel'sche, fehlt es der
Stimme an Intensität und dem Vortrag an Charakter; auch sind die
Töne der tiefern Octave klanglos. Im Messias konnte daher der junge
Künstler nicht befriedigen, und noch weniger in Beethovens neunter
Sinfonie. Dagegen erntete er im Vortrage der Cavatine aus
Mendelssohn's Paulus und der Beethoven'schen Adelaide (s. unten)
verdienten und rauschenden Beifall.
Bei Herrn Salomon,
Mitglied der
königlichen Oper in Berlin, kehrt sich das Verhältniss in gewisser
Hinsicht um. Herr Salomon hat ein schönes vollkräftiges
Stimmmaterial, dessen Klangfülle auch grossen Räumen leicht gerecht
wird. Allein seine Tonbildung ist mangelhaft; sein Ton ist zu kehlig
und fett, manchmal gequetscht, und das ist bei den schönen
Mitteln wahrhaft zu bedauern. Von bedeutender technischer
Fertigkeit kann auch nicht die Rede sein, und der Vortrag im
Oratorium war kalt und entbehrte dennoch jener edeln Ruhe, mit
welcher der Kunstgenosse Salomon's in Berlin, der Bassist
Krause, in dieser Gattung
kirchlicher Musik so schön wirkt. Es
ist immer wieder die alte Litanei unserer Zeit: die Lunge triumphirt,
und die Kunst des Gesangs hüllt sich in immer dichtere Schleier. Und
bei solchen Zuständen tritt eine unverständige, rohe Kritik,
zumal in Deutschland, noch gegen Erscheinungen wie die Sontag,
Novello, Roger auf, anstatt dass sie Gott danken sollte, dass
solche Priester noch vorhanden sind, um die heilige Flamme der Kunst
auf dem Altar der Muse des Gesangs wenigstens noch so lange
lodern zu lassen, bis die Cyclopen ihn zertrümmern! Nach einigen
Stellen in Herrn Salomon's Leistungen am Musikfest verzweifeln
wir jedoch noch nicht an seiner Künstlerlaufbahn: aber ohne
beharrliches Studium ist es leider heut zu Tage wohl möglich eine
gute Theateranstellung zu erhalten, aber nimmermehr das Ziel des
wahren Künstlers zu erreichen.
Beim Schlusse unseres Berichts über
den Messias müssen wir noch anführen, dass es allerdings
zweifelhaft ist, ob die Bezeichnung der 4 Stimmen im Anfang des
Chors Nr. 13 (wie auch in Nr. 20) als Soli von Händel oder von
Mozart herrühre; das letztere ist sogar wahrscheinlicher: in sofern
lässt sich dann die Art, wie Dr. Schumann es singen liess, nämlich
im Chor, rechtfertigen. Wenn uns aber doch einmal der
Mozart-Händel'sche Messias gegeben wird, so kann uns ein Stückchen
Restauration nichts helfen, und wenn jedem Dirigenten überlassen
wird, nach seiner Ansicht einzelnes von Mozart wieder aufzugeben, so
wissen wir am Ende gar nicht mehr, was wir eigentlich haben.
Wir
kommen zum zweiten Tage. Er brachte ein echt musikalisches Programm:
C. M. v. Weber's Ouvertüre zur
Euryanthe, F. Hiller's 125.
Psalm,
den ersten Act von Gluck's
Alceste und Beethoven's
neunte Sinfonie.
Nur war ein einzelnes Solo-Gesangstück zwischen der Weber'schen
Ouvertüre und dem Hiller'schen Psalm angesetzt, was freilich nicht
ganz passend war. Ursprünglich sollte es die Sopran-Arie aus
Mendelssohn's Elias sein „Höre, Israel!“, gesungen von Fräul.
Natalie Eschborn vom
Hoftheater in Stuttgart. Da aber diese
Sängerin nicht beim Feste war (das Comité blieb die geziemende
Anzeige über ihre Abwesenheit schuldig), so wurde statt jener die
Tenor-Cavatine aus dem Paulus eingeschoben, und, was wir denn
hier gleich bemerken wollen, von Herrn von der Osten zart und schön
gesungen, was auch vom Publikum anerkannt wurde. Sollte etwa der Name
Mendelssohn durchaus auf das
Programm? Das wäre allerdings in
Düsseldorf, wo der Verewigte seinen Paulus schrieb, ganz an der
Stelle gewesen; allein dann war eine einzelne Cavatine nicht
bedeutend genug, ihn zu vertreten: ein schöner Act der Pietät würde
es aber gewesen sein, wenn Frau Schumann am dritten Tage, statt einer
Composition ihres Gatten, ein Clavierconcert seines berühmten
Vorgängers in Düsseldorf gespielt hätte. Nun, es ist Schumann und
dem Comité wohl eben nicht eingefallen, dass das wohl hübsch
gewesen wäre.
Die Ouvertüre zur Euryanthe wurde mit Kraft und
Feuer
ausgeführt; das Orchester war überhaupt, wie schon gesagt,
vortrefflich. Dennoch sollte sich dessen Virtuosität, wie wir
sehen werden, später noch glanzvoller bewähren. Die
terrassenförmige Aufstellung hätte wohl etwas mehr in die Höhe
steigen können.
Der 125. Psalm
von Ferdinand Hiller ist eine
der
schönsten Compositionen, welche die neuere Zeit für diese ernste
Gattung aufzuweisen hat. Namentlich ist der erste Chor: „Die
auf den Herrn hoffen, die werden nicht fallen“ in jeder Hinsicht,
in Erfindung und Durchführung, in Verschmelzung des Gesang- und
Instrumentalchores ein Meisterstück, während der Schlusschor: „aber
Friede sei über Israel“ eine selige Ruhe in so schönen Melodieen
und Harmonieen athmet, dass selbst in manchem Männerauge Thränen
glänzten. Dieser Psalm schliesst sich würdig dem Oratorium „Die
Zerstörung von Jerusalem“ an, und Hiller ist unstreitig der
einzige unter den Zeitgenossen, welcher Mendelssohn in der
Composition kirchlicher Musik ersetzen kann. Dabei hat er den grossen
Vorzug, dass er sich nicht in eine gewisse Manier verrannt hat und
dass ein richtiges ästhetisches Gefühl ihn eben so sehr vor
der neumodischen Rauhheit schroffer Harmonieen und unsangbarer
Melodieen bewahrt, als vor dem Einerlei einer gewissen
Cantilenenform und der allzu gewischten Glätte. In dem Psalm
ist uns nur Eins aufgefallen, nämlich die Wichtigkeit, welche die
Composition auf die Worte: „Um Jerusalem her sind Berge“
legt; sie scheinen uns im Zusammenhang des Ganzen nicht so grosser
Bedeutung werth. Die Ausführung war unter der sichern Leitung des
Componisten, der überhaupt am zweiten Tage dirigirte,
vorzüglich. Schade war es, dass Herr Koch,
welcher das
Tenorsolo in der Probe so vortrefflich sang,
dass nur Eine Stimme darüber war, dass ihm die Soli im Messias
hätten anvertraut werden müssen, am Abend der Aufführung
nicht so gut disponirt war, wie am Morgen.
Es folgte der erste
Act von Gluck's Alceste. Wir
sind im Allgemeinen nicht für
Opernmusik an Musikfesten, schon um der Componisten selbst willen, da
man den Aufführungen im Concertsaale, wie wir schon oft in den
Aufsätzen über unsere Feste bemerkt haben, die Hälfte der
Bedingungen entzieht, welche zu ihrem vollständigen Eindruck
gehören. Allein keine Regel ohne Ausnahme. Gluck's Opern sind von
der Bühne verschwunden – kaum, dass man in Berlin, wo sie zur Zeit
der Milder-Hauptmann und später der Fassmann noch ein bleibendes
Asyl gefunden, jetzt wagt, sie dann und wann in Scene zu setzen, was
gewöhnlich nur auf Befehl des Königs geschieht, dessen hoher
und feingebildeter Kunstsinn noch vor wenig Tagen die Iphigenia
zur Festoper bestimmte. Wo soll nun ein Kunstfreund sich über
den Verfall der dramatischen Musik trösten und zu der Hoffnung auf
einen neuen Genius aufrichten, wo soll der jugendliche Künstler,
dessen Ohr umschwirrt wird von den Verkündigungen eines neuen
Messias für die Oper, Gelegenheit haben, die Carricatur Gluck's
von dem wahren Bilde des
Heros unterscheiden zu lernen, wo soll
er begeistert werden, sich dem heiligen Priesterstande der Kunst zu
weihen und das Gemeine abzuschwören, wenn nicht da, wo er jene
unsterblichen Werke wieder einmal hört, oder, was heut zu Tage gar
nicht selten sein dürfte, zum ersten Male hört?
Schon deswegen
verfällt Gluck's Musik recht eigentlich den Musikfesten, deren
Aufgabe es ist, das Monumentale in der Kunst vor der Bilderstürmerei
der heutigen Kunstwühler zu retten und zn sichern. Gluck's Alceste
und seine beiden Iphigenien sind antike Tragödien; ja, wenn
Einer sie heidnische Oratorien nennen wollte, so hätten wir
kaum etwas dagegen. Wir wissen recht gut, dass die Gegenstände
dieser Opern dem Vorstellungskreise der heutigen Welt fern liegen;
aber wir wissen auch, dass die Declamationen gegen das Antike
überhaupt zwar Mode sind, aber in der Regel auf Unbekanntschaft mit
demselben und auf Mangel an Empfänglichkeit und Bildung für
Aufnahme seines hohen Geistes beruhen. Es wird keinen Stoff der
antiken Tragödie geben, der nicht im Rein-Menschlichen aufgeht, und
wir begreifen nicht, warum die antiken Sagen in musikalischem
Gewande nicht eben so viel Theilnahme erregen sollten, als z. B. die
alttestamentlichen, da es noch sehr bestreitbar sein dürfte, ob das
Ertrinken von Pharao's Heer im rothen Meer ein grösseres Interesse
für die Welt des neunzehnten Jahrhunderts hat, als das erhabene
Opfer einer Gattin, die für ihren Gatten in den Tod geht.
Aber
abgesehen davon kommt es für unsern Fall ja gar nicht auf die
Theilnahme an, welche die Handlung, die im Text ausgedrückt
ist, in uns erregt, sondern es ist hier nur vom Cultus der Musik die
Rede, vom Cultus einer der Heroen der Tonkunst, der nicht untergehen
darf, und zwar deshalb nicht, weil er die Tiefe der menschlichen Empfindung in
Tönen der Wahrheit ausgesprochen hat: ob da
grichische, oder gothische, deutsche, italiänische oder
französische Mythe oder Poesie zu Grunde liegt, ist gleichgültig.
Ausserdem ist auch das ein Grund für die Aufführung
Gluck'scher Musik auf den Musikfesten, dass in der Regel nur bei
diesen letztern diejenigen ausgezeichneten Kräfte gefunden
werden können, welche dem Vortrage jener Musik gewachsen sind.
Wir
hatten daher die Wahl des Comité's mit Freuden vernommen und
haben durch die Ausführung des I. Actes der Alceste einen
Kunstgenuss empfunden, der zu den schönsten Erinnerungen aus der
ganzen Reihe unserer Musikfeste gehören wird. Clara Novello war
gross und herrlich im Recitativ und in den Arien. Die Arie aus
Es-dur: „Erhört nur dies
noch“, die wunderschöne in D-dur:
„Nein! in den Tod mich hinzugeben“ und endlich die Selbstweihe
zum Opfertode: „Ihr Götter ew'ger Nacht!“ – wo kann man
Edleres, Tieferes, Erhabeneres hören, als solche Compositionen
durch solchen Gesang in's Leben gerufen P Hieher, vor diesen Altar
knieet hin und bekennt die Lästerung des Namens Gluck, die ihr so
oft aussprecht als ihr euren Götzen des Drama's der Zukunft jenem
Namen gegenüber oder gar über ihn stellt! Hier lernt, was die Arie
vermag, die ihr verschmäht; hier lernt, was Melodie ist, die
aus der Seele quillt, die Poesie des Worts vergeistigt und belebt,
und dabei doch Musik, und
dabei doch Gesang bleibt, und
gesteht, dass
bei euch keine Ahnung davon zu finden ist. Und wenn euch dann die
Anhörung des Priestermarsches aus G-dur,
der wie ein milder Vollmond
aus dem Meere aufsteigt und in erhabener Ruhe an dem Horizonte
heraufschwebt, und der Ton des Orakels mit seinen erschütternden
Harmonieen – das Urbild der Mozart'schen Grabesstimme des Comthurs
– nicht im Innersten ergreifen und zur Anbetung des Einfach-Schönen
zurückführen, so mögt ihr zu dem Lärm der
grossen Trommel, der Posaunen und vierundzwanzig Trompeten nebst
Zubehör auf euer ganzes Leben verdammt sein!
Gegen Frau Novello fiel
Herr Salomon als Oberpriester im dramatischen Vortrag und
überhaupt in der Auffassung Gluck's ab. Wir konnten besonders bei
der prächtigen Scene im Tempel eben nicht merken, dass er „voll
von dem Geiste des Gottes“ sei und dass „heilige Schauer ihn
durchbebten“. Jedoch entfaltete er bei den Worten „Der Marmor
bebt u. s. w..“ auf c und d eine herrliche Tonfülle und
zeigte zu
unserer Freude, dass er doch auch im Stande sei, etwas in die Stimme
zu legen. Warum nicht immer so?

| serial number | year | place | Directors of festival | specifics/premiere/significant soloists (selection) |
| 0 | 1817 | Elberfeld | Johannes Schornstein | Officially it doesn't ranking to this cycle, but it believes as an initial spark; |
| 1 | 1818 | Düsseldorf | Friedrich August Burgmüller | Top priority: The Seasons and Schöpfungsmesse of Joseph Haydn; Soloist: Johannes Schornstein (piano) |
| 2 | 1819 | Elberfeld | Johann Schornstein | |
| 3 | 1820 | Düsseldorf | Friedrich August Burgmüller | German premiere of the oratorio "Samson" of George Frideric Handel; Soloist: Johannes Schornstein (piano) |
| 4 | 1821 | Cologne | Friedrich August Burgmüller, | The city of Cologne new in the programme; inter alia promote through Erich Verkenius, president of the Cologne University of Music |
| 5 | 1822 | Düsseldorf | Friedrich August Burgmüller | world premiere of the oratorio "Das befreite Jerusalem" of Abbé Maximilian Stadler; For logistic reasons Düsseldorf deputized for Elberfeld. At first-time in the hall of knights of the old castle of Düsseldorf. |
| 6 | 1823 | Elberfeld | Johannes Schornstein | |
| 7 | 1824 | Cologne | Friedrich Schneider | World premiere of the oratorio "Die Sündflut" of Friedrich Schneider |
| 8 | 1825 | Aachen | Ferdinand Ries | City of Aachen new in the programme; German premiere of the Symphony No.9 of Ludwig van Beethoven in celebration of opening of Theater Aachen |
| 9 | 1826 | Düsseldorf | Louis Spohr and Ferdinand Ries | Düsseldorf premiere of the oratorio "The Last Judgement" of Louis Spohr (Text: Johann Friedrich Rochlitz) and the Symphony Nr. 6 D major op. 146 of F. Ries; First-time the festival takes over three days. |
| 10 | 1827 | Elberfeld | Johann Schornstein and Erich Verkenius | Last participation of the City of Elberfeld; |
| 11 | 1828 | Cologne | Bernhard Klein, Ferdinand Ries and Carl Leibl | World premiere of the oratorio "Jephtha" of B. Klein and a new recording concert overture at "Don Carlos" of F. Ries |
| 12 | 1829 | Aachen | Ferdinand Ries | |
| 13 | 1830 | Düsseldorf | Ferdinand Ries | German premiere of the overture "Braut von Messina" op. 162 of F. Ries, (Text: Friedrich Schiller), also Düsseldorf premiere of the oratorio "Judas Maccabaeus" of G. F. Handel |
| 14 | 1832 | Cologne | Ferdinand Ries | |
| 15 | 1833 | Düsseldorf | Felix Mendelssohn | German premiere of Symphony No. 4 (The Italian) and a "festival-overture" of F. Mendelssohn, also the oratorio Israel in Egypt in the German original version of G. F. Handel; new in the programme: morning concerts |
| 16 | 1834 | Aachen | Ferdinand Ries | Soloist: Frédéric Chopin (piano) |
| 17 | 1835 | Cologne | Felix Mendelssohn | Solomon of G. F. Handel in original score and with comp of organ; Choir master: Fanny Mendelssohn |
| 18 | 1836 | Düsseldorf | Felix Mendelssohn | World premiere of the oratorio "St. Paul" of F. Mendelssohn; Choir master: J. Schornstein |
| 19 | 1837 | Aachen | Ferdinand Ries | World premiere of the oratorio "Die Könige in Israel" of Ferdinand Ries |
| 20 | 1838 | Cologne | Felix Mendelssohn | |
| 21 | 1839 | Düsseldorf | Felix Mendelssohn | Guest appearance and successfully artistic breakthrough of the composer Hubert Ferdinand Kufferath; world premiere of a festival-overture of Julius Rietz; Choir master: J. Schornstein |
| 22 | 1840 | Aachen | Louis Spohr | |
| 23 | 1841 | Cologne | Conradin Kreutzer | |
| 24 | 1842 | Düsseldorf | Felix Mendelssohn | |
| 25 | 1843 | Aachen | Carl Gottlieb Reissiger | |
| 26 | 1844 | Cologne | Heinrich Dorn | German premiere of Missa Solemnis D major op. 123 of L. v. Beethoven |
| 27 | 1845 | Düsseldorf | Julius Rietz | German premiere of the "Requiem" of Wolfgang Amadeus Mozart; Nine years pause follows because the Revolutions of 1848 in the German states |
| 28 | 1846 | Aachen | Felix Mendelssohn | Soloist and discovery of the "Swedish Nightingale" Jenny Lind (soprano) |
| 29 | 1847 | Cologne | Heinrich Dorn, Gaspare Spontini and George Onslow | German premiere of the Symphony No. 4 G major op. 71 of G. Onslow |
| 30 | 1851 | Aachen | Peter Josef von Lindpaintner | |
| 31 | 1853 | Düsseldorf | Robert Schumann, Ferdinand Hiller and Julius Tausch | World premiere of the Symphony No. 4 d-minor op. 120 and the festival-overture Op. 123 of R. Schumann; Soloist: Clara Schumann (piano) and Joseph Joachim (violin); |

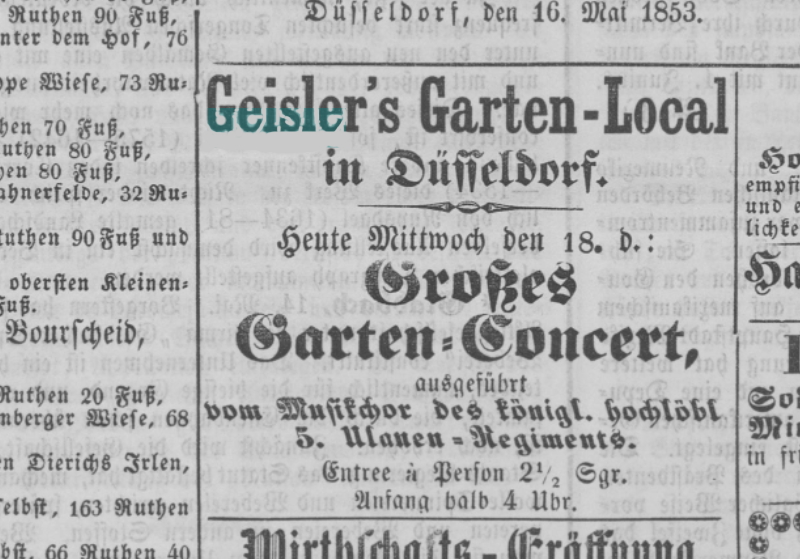



Darin über 60 Seiten Nachbemerkungen.
Wolfgang Müller von Königswinter
Junge Lieder
Die wunderbar romantischen Dichtungen von 1841 endlich in heutiger Schrift
Zugleich aber der Originaltext des
stürmischen Poeten in der herrlichen Rechtschreibung von damals
DIREKTLINK ZU Wolfgang
Müller von
Königswinter: JUNGE LIEDER
(das Buch
erschien
im Dezember 2022, zusätzlich als E-Book dann im Januar 2023)
Schauen Sie auch auf der Homepage-Seite Komponistinnen/en-Liste
dazu für



HOME
Siehe u. a. auch:
Tabellarische
Zeitleisten-Biografie zu Müller. |||
Liste
Bücher Publikationen Veröffentlichungen
zu Wolfgang Müller von Königswinter |||
Auch Müller-Gedicht-Vertonungen |||
Alphabetische
Titelliste der Gedichte Texte Buchtitel
et al. Wolfgang
Müller von Königswinter






HOME
= index.html | | | Sitemap
Goethe
alias die Leiden des jungen
Werthers in der globalisierten Welt
5
AUDIO-CDS u 1 E-BOOK Deutsch so einfach – Hören
Sprechen Üben
Interessante
Details über Shona (Schona) – eine Bantusprache in Simbabwe
(Zimbabwe)
Die
Anfänge des Tagesspiegels
ODER Die Anfänge der Tageszeitung
"DER TAGESSPIEGEL" von 1945
bis zum Frühjahr 1946 in Berlin
Yoffz der Trainer spricht
zum morgigen
K.o.-Spiel
Bilder aus China Teil I und II von 1877 ||| Junge Lieder

Die
paar Hundert Absahner | Der zornig-ironische Essay über den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Platzierung und
Vermarktung von Büchern aus Großverlagen/Verlagsketten,
gerade in den Talkshows. | Aber auch in anderen Sendeformaten. Die
paar Hundert Absahner |

Abkehr
| Bücher
| Zu den
Radionachrichten | Ergo Ego | HOME
| Radiophile
Untertöne |
Oh
Ehrenbreitstein | Zur
Physiologie des Kusses | Mixtur
| Essay
über Köln |
Lob der
Landcruiser |
Der Essay
zum Thema #Aufschreiben |
Der ewig
herrliche Trend KURZPROSA-GEDICHT | Kurzprosa INTERESSEN |
Kurzprosa "Ein Leichtathletik-Trainer spricht" |
Kurzprosa vom Briefmarkenbeaufragten NEUES AUS DEM BEAUFTRAGTEN-PORTOWESEN |
Die Rollladenverordnung -- Oh ... Welt bürokratischer Tücken -- |
Das
Ärgernis POSTBANK und zudem die Lächerlichkeit ihrer
KI-Kunden-Beantwortungsmaschinerie |
Das
unerträgliche Kommentatoren-Gesabbel bei
Fernseh-Fußball-Spielen |
Glaube,
Liebe, Hoffnung – ein Essay über Religion
| Deutsch
lernen im Internet-Zeitalter |
DDRkundungen.
Beobachtungen aus dem Jahr 1990 | STADTGARTEN
9, Krefeld | STADTGARTEN
12, Krefeld |
Ein ganz
kurzer Sprach-Essay |
Essay
über Trier | Wonderful
Schönsprech |
Christian Lindner spricht wie sein eigener Klon | Auch noch ein Essay
|
Der
Verleger Ernst Röhre in Krefeld |
Die
Tragik von etlichen Wirtschaft(s)- und Zahlen-Artikeln | Doppel-Wort-Liste / Doppelwort: Man
verliest sich |
Häresie
im Traumland. Gedanken über das
Goethe-Institut |

Die Familie Bermbach, hier in der Linie
Camberg Wiesbaden Köln Krefeld et al.
DIREKT-LINK
Zu Adolph Bermbach, dem Mitglied der Paulskirchen-Versammlung. Kurze Biographie.
Der Prozess gegen das Mitglied der Nationalversammlung 1848/1849, Adolph Bermbach, am 9.1.1850 in Köln wegen Umsturz/Complott/Hochverrat etc.

DIREKT-LINK
ernst-faber-1895-china-in-historischer-beleuchtung-komplett-als-online-text.htm
Ernst Faber, 1895, "China in
historischer Beleuchtung" ||| komplett
als offener Online-Text
DIREKT-LINK
ernst-faber-1895-china-in-historischer-beleuchtung-komplett-als-online-text.htm
UND EINE KLEINE BIBLIOGRAFIE ZU ERNST FABER IST HIER:
DIREKT-LINK
buecher-und-publikationen-von-ernst-faber.htm


Wolfgang Müller von Königswinter STARTSEITE alle Müller-Pages bei klausjans.de
von/zu
Wolfgang Müller von Königswinter
TABELLARISCHE
BIOGRAFIE
Zeitleiste
von/zu
Wolfgang Müller von Königswinter, TEIL 1
W. M. v.
K.
TABELLARISCHE
BIOGRAFIE
Zeitleiste
von/zu
Wolfgang Müller von Königswinter, TEIL 2.
Liste der Bücher | Publikationen | Veröffentlichungen (Bibliografie) zu/für/von Wolfgang Müller von Königswinter.
Bislang bekannte Briefe an
und von Wolfgang Müller von
Königswinter
Komponistinnen/en-Liste
zu
"Junge
Lieder"
Ein paar T e x t e
von Wolfgang Müller von
Königswinter
Alphabetische
Titelliste der Gedichte Texte Buchtitel
et al. Wolfgang
Müller von Königswinter
Einige Personen
zu und um Wolfgang Müller von
Königswinter
RHEINWEINLIED Vergleich Version MATTHIAS CLAUDIUS und Neo-Version WOLFGANG MÜLLER VON KÖNIGSWINTER
IMPRESSUM
||| DATENSCHUTZERKLÄRUNG
||| Sitemap
||| HOME